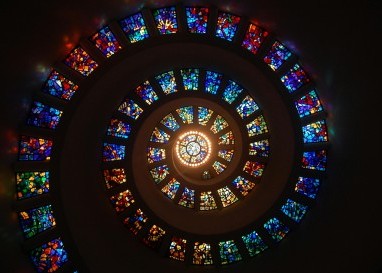In diesem Jahr wäre Erika Burkart 100 Jahre alt geworden. Sie gehört längst zum Kanon der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, die Aargauer Lyrikerin erhielt bedeutende Literaturpreise, 2005 etwa als erste Frau den Grossen Schillerpreis für ihr Lebenswerk. Ihr dichterischer Kosmos spannt sich auf zwischen ihrem beseelten irdischen Garten in Aristau und dem himmlischen, bevölkert von Engeln und Göttern. Dazwischen zirkulieren Vögel als Boten. Sie sind die Metaphern dafür, dass das Wesentliche schwer in Sprache zu fassen ist: «im Flug musst du’s fassen / [...] musst es halten / wie einen Vogel: frei / denn das Wort will fliegen», heisst es in «Das Wort». Besonders Burkarts Frühwerk ist eine Art Schöpfungslyrik (Philipp Theison). Manche bezeichnen Burkart deshalb als «spirituelle Dichterin», etwa das lesenswerte Bändchen «Im Gegenzauber», mit dem sie der TVZ-Verlag zum Hundertsten ehrte.
Zauberworte gegen den Zweifel
Erika Burkart war eine grosse Poetin der spirituellen Suche. Der Briefwechsel mit ihrem Förderer und Freund Carl Seelig ist jetzt veröffentlicht und zeigt neue Facetten auf.
Erika Burkart, Schweizer Dichterin von Weltformat, mit «stets gefährdeter Existenz». (Foto: Limmat-Verlag)

Das Etwas hinter dem Nichts
Tatsächlich nutzt die junge Erika Burkart die Dichtung als Tor zur geheiligten Welt. Stefan George ist ihr Vorbild und dient ihr ab 1950 als Stütze im «ewig gültigen» künstlerischen Ringen. Dabei ringt sie mit «dem Vogel, der manchmal ein Engel ist», ihre Wortsuche richtet sich immer auch an ein höheres Gegenüber: «ich lasse dich nicht, du segnest mich denn ...» und «Denk nicht dass dort nichts ist wo du nichts siehst» zitiert sie George und nimmt sich diese beiden poetischen Formeln zu Leitsprüchen. Solche vollkommenen Formulierungen seien Trost «kurzum ein Wunder, das uns an das Göttliche im Menschen wieder glauben lässt.»
Oft genug glänzt das Göttliche in Burkarts Werk aber auch durch Abwesenheit, die verarbeitet, beschworen werden muss; als «Wind aus Unerhörtem», als «unberührbare Nähe». «Gottgeist-Immer ... Bleib verborgen, damit ich sehe.» Es gilt sich mit dem Widersprüchlichen zu arrangieren: «Gott, unsere unglückliche Liebe: als solche dauerhaft, ja ewig» beschreibt sie das paradoxe Verhältnis.
Die Zähne des Zweifels
Nach der Trennung von ihrem ersten Mann steckt Burkart 1959 in einer tiefen Krise, und ein fast 30 Jahre älterer Bewunderer nimmt sich ihrer an: der Journalist und Literaturkritiker Carl Seelig. Der brillante Netzwerker hielt grosse Stücke auf die fragile Poetin. Und er ermunterte sie, weiterzuarbeiten. Seelig schrieb ihr: «Exupéry: gut. Erika Burkart: besser.» Verbunden mit dem Vorschlag, einen Jugendroman zu schreiben. Und kurz darauf: «Es ist schön, dass es Sie auf dieser Welt gibt und Ihre Gedichte.» Im allerersten Brief von 1958 antwortete Burkart auf das Lob: «Ich kann Ihnen nicht sagen, wie dieses Wort mir hilft an der innersten Stelle, dort, wo wir bitter sind, wo ohne Unterlass der Zweifel nagt.»
«Sehr verehrter, lieber Herr Doktor!» Der erste Brief Erika Burkarts an Carl Seelig von 1958. (Quelle: Zentralbibliothek Zürich, Nachlass Carl Seelig)
Eine tragende Existenz
Nach Carl Seeligs Tod 1962 schrieb Erika Burkart: «Ihn, den Freund, auf dieser Erde zu wissen, war für mich eine Art Lebenspass, seine Existenz hat die meine, stets gefährdete mittragen helfen.»
Eine Ausstellung beleuchtet diese Freundschaft nun anhand von Briefen und geht zudem auf Seeligs Briefwechsel mit Hermann Hesse und Robert Walser ein. Auch diese Autoren versuchten, das Naturerlebnis als transzendente Erfahrung zu beschreiben.
Ausstellung: Carl Seelig. Drei Briefwechsel. Bis 8. Januar, Strauhof, Zürich. www.strauhof.ch
Bücher:
- Carl Seelig: Briefwechsel. Hg. von Lukas Gloor und Pino Dietiker. Suhrkamp. Berlin 2022. 372 Seiten, Fr. 45.-
- Ursina
Sommer (Hg.): Im Gegenzauber. TVZ, 2022, 208 Seiten, Fr.
29.80
– Ernst
Halter (Hg.): Spiegelschrift. Limmat-Verlag, 2022, 336 Seiten,
Fr. 44.–
– Tabea
Steiner: Wortfächer Erika Burkart. Vatter & Vatter, 2022,
Fr. 17.–
– Doris
Stump (Hg.): Die Kunst, Leben in Schrift zu verwandeln.
eFeF, 2022, 300 Seiten, Fr. 30.–
Der junge Kulturjournalist Carl Seelig um 1930. (Foto: Keystone SDA/Robert Walser-Stiftung Bern)