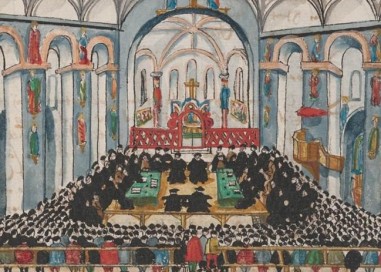Wenn Walter Schels etwas nicht ausstehen kann, dann ist es ein lächelndes Gesicht. Zumindest nicht, wenn er es fotografiert. Denn der deutsche Fotograf mit dem Pagenschnitt und dem markigen Gesicht sagt es klipp und klar: «Das Lachen ist nur eine Verlegenheit, ein Ablenken von der eigentlich nicht auf Heiterkeit angelegten Seele des Menschen.»
Und Ablenkung interessiert ihn nicht. Er will das Wahre zeigen. So sind dies denn auch keine strahlenden Schönheiten mit blitzend weissen Zähnen. Sondern von Krankheit gezeichnete Menschen, die kurz vor dem Tod stehen oder gerade gestorben sind. Und diese lachen nicht. Vergangenen Freitag hat die Ausstellung «Noch mal leben vor dem Tod» in der Limmat Hall im Kreis 5 ihre Tore geöffnet. In zahlreichen Städten der Welt feierte sie bereits Erfolge. Auf Initiative der Reformierten Landeskirche Kanton Zürich ist die eindrückliche Schau nun in Zürich zu sehen (siehe rechts).
Nicht gruselig. Fotograf Schels ist zusammen mit seiner Partnerin, der Journalistin Beate Lakotta, angereist. Sie hat die Begleittexte zu den Bilder geschrieben und verrät an der Vernissage, warum diese Arbeit überhaupt entstanden ist: «Aus persönlichen Gründen.» Denn die beiden haben einen Altersunterschied von mehr als dreissig Jahren. «Es gab eine Zeit, wo Walter Angst hatte vor dem Tod und ich davor, ihn zu verlieren.» Sie wollten dem Tod in die Augen sehen in der Hoffnung, dass die Angst dadurch kleiner würde. «Weil wir beide Berufe haben, die uns dies erlauben, haben wir uns an die Arbeit gemacht.» Während eines Jahres haben sie unheilbar kranke Menschen in einem Berliner Hospiz gebeten, sie in den letzten Wochen begleiten und vor und nach dem Tod fotografieren zu dürfen. Was dabei rausgekommen ist, ist keinesfalls gruselig oder gar abstossend. Viel mehr berühren die Bilder in ihrer ästhetisch inszenierten Intimität und Ungeschminktheit. In der
weitläufigen Halle kommen die grossformatigen Schwarz-Weiss-Porträts perfekt zur Geltung; die hohen Fenster geben den Blick frei auf die Limmat. «Das Leben fliesst vorbei», sagt Lakotta. Drinnen ist man mit den Geschichten der Toten konfrontiert. «Sie waren froh, mit uns zu reden und erzählten uns Dinge, die sie sonst niemandem sagen konnten.» Lakotta: «Wir waren wie Auffangbehälter.»
Da ist zum Beispiel der Herr Müller, der bei der Bahn arbeitete und fast auf die Minute genau wusste, wann er sterben wird. Als wäre sogar sein Tod nach Fahrplan abgelaufen. Und als Pendant der Herr Wegner, der über ein Jahr im Hospiz lebte, sterben wollte, aber nicht konnte. Als er an der Weihnachtsfeier Orgel spielte, wurde er aufgefordert, das Hospiz zu verlassen. In der Nacht darauf starb er. Oder die Frau Schöffler, die eine ganz «herrische Art» hatte und es gewohnt war, dass die Leute ihr gehorchten. Am Schluss aber sanft und mit ihrem Ex-Mann versöhnt einschlafen durfte. «Manchmal werden die Menschen in der letzten Phase gerade gegenteilig zu dem, wie sie im Leben waren», sagt Schels.
Unter Tränen. Ein Happy End gibt es nicht immer. Der auf den Ausstellungsplakaten abgebildete Werber Heiner Schmitz hatte bis zu seinem Tod ständig Besuch von Freunden. Sie sahen Fussball, tranken Bier. «Doch in seiner existenziellen Not wurde er nicht wahrgenommen, was ihn schmerzte», weiss Schels. Beim Erzählen kämpfen die Beiden immer wieder mit den Tränen. Auch vor dem Bild des kleinen Mädchens, das an einem Hirntumor starb. Es sieht friedlich aus, als würde es schlafen. «Bei Kindern war die Trauer der Eltern schwer zu ertragen», sagt Schels. Dass ihre Kinder in den Bildern weiterleben, war jedoch tröstlich für sie. Ob er die Angst vor dem Sterben jetzt verloren habe? «Nein», antwortet Schels. «Aber vor Toten.» Sein Trauma sass tief: Im Krieg aufgewachsen, musste er als Kind viele Leichen und Leichenteile sehen.
Für Beate Lakotta hat die Arbeit eine wichtige Erkenntnis gebracht: «Viele physische Leiden können heute genommen werden. Die Medizin ist so weit, dass man zumindest hoffen darf, nicht mit allzu grossen Schmerzen aus dem Leben zu scheiden. Und das ist beruhigend.»
Obwohl die Schicksale mitunter sehr traurig sind. Schels sagt den entscheidenden Satz: «Die Besucher verlassen die Ausstellung immer zufrieden. Im Bewusstsein nämlich: Ich lebe noch.»