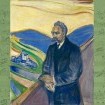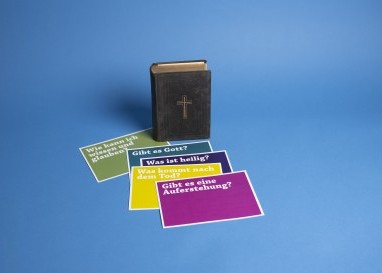Statistik ist grundsätzlich gnadenlos: Im Jahr 2020 waren in der Schweiz 1,57 Millionen Menschen als evangelisch-reformiert gemeldet, ein Jahr später waren es noch 1,53 Millionen. Das entspricht einem Rückgang von 40'000 Mitgliedern beziehungsweise von 21,8 auf 21,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Anteil von Mitgliedern der römisch-katholischen Kirche an der Gesamtbevölkerung sank auf höherem Niveau verhältnismässig ähnlich: von 33,8 Prozent im Jahr 2020 auf 32,9 Prozent ein Jahr später.
Längerfristig ging gemäss Bundesamt für Statistik der Anteil der Reformierten seit 1970 kontinuierlich zurück: Von 48,8 Prozent auf eben 21,1 Prozent im Jahr 2021. Leicht zugenommen habe dagegen der Anteil anderer christlicher Gemeinschaften wie die Christkatholische Kirche, orthodoxe Gemeinschaften und Freikirchen: Zusammen gehören ihnen zurzeit 5,6 Prozent der Bevölkerung an.
Viele Religionen, ein Evangelium
Die aktuelle Situation hat den Dachverband Freikirchen.ch veranlasst, ihr Resultat als positiv herauszustreichen. Im Gegensatz zu den Landeskirchen zeige eine Auswertung von 2019 – 2022, dass in der Schweiz die Zahlen der Freikirchen stabil blieben und sogar 22 neue Lokalkirchen gegründet worden seien, schreibt der Verband in einer Mitteilung.