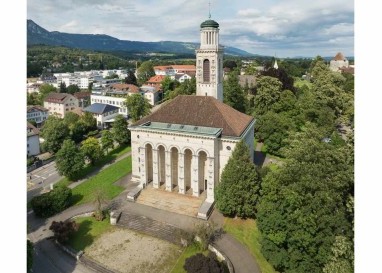Maja Storch ist Inhaberin, Mitbegründerin und wissenschaftliche
Leiterin des Instituts für Selbstmanagement und Motivation Zürich ISMZ, einem
Spin-off der Universität Zürich. Sie hat Psychologie, Philosophie und Pädagogik
studiert und arbeitete als Jung'sche Psychoanalytikerin, Trainerin und
Psychodramatherapeutin. Bekannt wurde sie vor allem durch das Zürcher
Ressourcen Modell (ZRM), welches sie
zusammen mit Frank Krause entwickelte. Am 11. November 2021 hat sie in Zürich für ihre
wissenschaftliche Arbeit rund um «Selbst und Selbstbestimmung» den renommierten
Egnér-Preis für Psychologie verliehen bekommen. Gemeinsam mit dem Theologen
Julius Kuhl aus Osnabrück: Kuhl setzt sich in seinem Buch «Spirituelle
Intelligenz» dafür ein, dass sich die Theologie vermehrt auch mit dem durch die
Neurobiologie und Psychologie veränderten Blick auf das Seelenleben
auseinandersetzt.
Storch ist Autorin zahlreicher
Sachbücher, etwa über kluges Entscheiden, Verhaltensänderungen und Beziehungen.
Ihr neustes Buch «Spirituelles Embodiment» befasst sich mit dem Körper «als
Schlüssel zu unserem wahren Selbst». Die Botschaft: Es sei höchste Zeit, den Körper in die spirituelle Praxis einzubeziehen. Der spirituelle Ratgeber enthält u.a. auch Selbsttests für die Auswahl persönlicher Psalmen, ausserdem stehen Videos zu Körpergebeten und gregorianische Gesänge als Download zur Verfügung. Maja Storch wohnt in der Nähe von Singen in einer alten Kaplanei neben der
Kirche, wo auch «ihre» Orgel steht. Die Ausbildung zur Organistin war für sie
ein Schlüsselerlebnis; sie beschloss die Ressourcen, welche althergebrachte,
christliche Praktiken bieten, vermehrt auch für ihre psychologische Arbeit zu
nutzen. Sie propagiert die zusätzlichen Möglichkeiten, die sich so für die
therapeutische Arbeit anbieten nicht nur in Buchform, sondern gibt sie auch in
Seminaren an psychologische Profis weiter.
www.majastorch.de