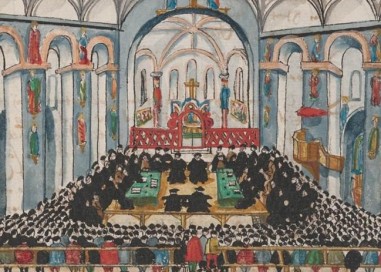Es war eine klare Ansage: 2018 verzichtete Gebana, der Pionier des fairen Handels, darauf, mit dem Wörtchen «fair» Werbung zu betreiben. Zu sehr bestimmten Nahrungsmittelmultis und Detailhändler die Bedingungen und das Marketing des fairen Handels. Das Modell von Gebana jedoch setzt unter dem Motto «Weltweit ab Hof» auf direkte Geschäftsbeziehungen zwischen Produzenten und Endkonsumenten. Dabei bezahlt Gebana seinen Partnern immer den Fairtrade-Mindestpreis und beteiligt sie mit zehn Prozent am Umsatz.
Das Jahr 2020 war wegen Corona für den Online-Händler Gebana und damit für die Farmer im Weltsüden ein gutes Jahr. Zahlen liegen noch keine vor. Sandra Dütschler, Sprecherin von Gebana, schätzt das Umsatzplus auf 50 Prozent. Den Produzenten von Mangos, Datteln oder Orangen könnte die Umsatzbeteiligung mehrere zusätzliche Monatseinkommen bescheren.
Davon können die westafrikanischen Kakaopflanzer nur träumen. Es war ein Schock für die beliebte Fairtrade-Stiftung Max Havelaar, als 2019 eine Reportage des «Kassensturz» ans Licht brachte, dass die in Fairtrade-Koopera-tiven zusammengeschlossenen Kakaofarmer der Elfenbeinküste und Ghanas mehrheitlich unter der Armutsgrenze leben. Nur gerade acht Rappen vom Verkaufspreis einer «fairen» Schoggitafel, die im Laden rund ein bis drei Franken kostet, gehen an sie.