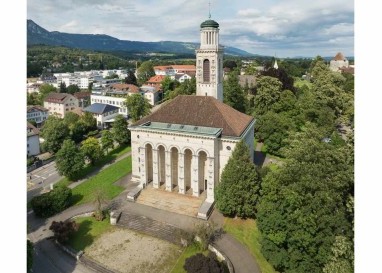«Spiritualität» ist ein viel benutztes Wort. Was bedeutet es eigentlich?
Hans-Rudolf Stucki: Heute ist Spiritualität ein weiter Begriff. Früher sprach man von «Frömmigkeit», von christlicher Frömmigkeit – und verstand darunter den in Familie und Umfeld gelebten christlichen Glauben.
Heute zieht man dem Ausdruck «Frömmigkeit» den Begriff «Spiritualität» vor, da er neutraler ist. Unter allgemeiner Spiritualität verstehe ich: verbunden sein mit dem Urgrund des Lebens, mit der Natur, mit dem Kosmos, mit den Mitmenschen, mit einem ethischen Hintergrund, mit Werten – und Teil davon sein.
Unter christlicher Spiritualität verstehe ich: verbunden sein mit dem göttlichen Urgrund, mit der Schöpfung, dem Schöpfer, den Mitmenschen, dem christlichen Glaubensgut und christlichen Werten – und als Geschöpf Teil der Schöpfung sein.
Man hört oft, dass jedem Menschen ein spirituelles Bedürfnis angeboren sei. Stimmt das?
Der Mensch hat das Verlangen, über sich hinauszugehen. Er sucht Rückbindung mit dem nächsthöheren System, mit Familie, mit der Natur, mit der Transzendenz. Er will das Leben ergründen, so auch mit Fragen wie: Woher komme ich, wohin gehe ich, was ist das Leben?
Das alles sind spirituelle Bedürfnisse. Es gibt Untersuchungen zur Spiritualität Erwachsener, die – wie erwartet – zeigen, dass deren Spiritualität unterschiedlich stark ausgebildet ist.
Sie haben ein Buch über die Spiritualität von Kindern und Jugendlichen geschrieben. Was hat Sie dazu motiviert?
Als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut sowie evangelischer Theologe interessieren mich insbesondere die Schnittflächen der beiden Disziplinen. Da bietet sich die Spiritualität an. Hinzu kommt, dass die Spiritualität von Kindern und Jugendlichen zu wenig thematisiert wird, im deutschen Sprachraum gibt es wenig Literatur dazu, im englischen mehr.
So will das Buch Eltern und Bezugspersonen für die Spiritualität der Heranwachsenden sensibilisieren. Fehlende Zeit zum Staunen, zum Träumen hindern Schulkinder, über sich hinaus zu gehen, selber kreativ und schöpferisch zu werden.
Ihr Buch heisst «Spiritualität wiederentdecken». Ist sie wirklich verloren gegangen?
Das ist sie natürlich nicht. Sie ist aber, wenn wir etwa die Kirchenaustritte im Auge haben, zum Teil entkirchlicht worden. Und vielfach liegt sie brach, denn ihre Notwendigkeit wird oft erst erkannt, wenn sie fehlt. Zum Beispiel bei einem Schulkind, das in der Klasse gemobbt wird und nicht mehr Verbundenheit mit der Klasse erlebt. Es gilt, der Spiritualität Raum zu geben, sie in diesem Sinne wieder zu entdecken.
Sind Kinder für das Geheimnisvolle, Unsagbare, Transzendente besonders empfänglich?
Kinder sind vor allem Gefühlswesen, sind sehr empfänglich für Stimmungen. Sie sind neugierig, hinterfragen die Welt aber noch nicht kritisch wie die Jugendlichen. So sind sie vom Geheimnisvollen, Unergründbaren leicht angezogen, lassen sich davon leicht beeinflussen.
Aber schon Vorschulkinder, wenn auch noch fussend im magisch-mythischen Denken, befassen sich mit den existentiellen Dingen. So fragen sie nach dem Dahinterliegenden, dem Transzendenten, dem sie noch näher verbunden sind als wir Erwachsenen. Letztlich geht es ihnen um die Frage: Kann ich dieser Welt – und die muss ja irgendwie gelenkt sein – ebenso vertrauen, wie ich Vater und Mutter vertrauen kann?
Inwiefern unterscheidet sich die kindliche von der erwachsenen Spiritualität?
Kinder sind sich im Gegensatz zum Erwachsenen ihrer Spiritualität nicht bewusst. Sie leben sie spontan und sprechen darüber. Sobald sie aber spüren, dass ihre eigenen, besonderen Erfahrungen von den Erwachsenen nicht angenommen, ja gar verlacht werden, verschliessen sie sich.
Erwachsene sind sich ihrer Spiritualität viel bewusster und können sich gezielt darin üben, zum Beispiel im Meditieren oder im Gebet. Sie können sich der Spiritualität im engeren Sinne, dem mystischen Erleben, jedoch nur öffnen und sich bereithalten; was wird, liegt nicht in ihrem Willen.
Junge Kinder hingegen bleiben empfänglich, allerdings auch für Ängste, die dabei auftreten können. Bekannte Aspekte spirituellen Erlebens wie Veränderung von Zeit- und Raumgefühl, Wärmeempfinden oder Lichtwahrnehmung finden sich bei Kindern und Erwachsenen.
Warum soll man Kinder zur Spiritualität hinführen?
Weil Spiritualität, weil Verbundenheit mit etwas Grösserem Halt, Sicherheit und Geborgenheit gibt – und letztlich Lebenssinn. Für das Kind geht es primär um die Verbundenheit mit seiner Familie, mit der Schulklasse, mit den Lebensfragen, um die Verbundenheit mit seinem eigenen konstruierten Weltgefüge, mit Gott.
Sie sprechen «etwas Grösseres» an, im Speziellen aber Gott. Fehlt Kindern ohne religiöse Erziehung etwas?
Kindern ohne religiöse Erziehung fehlt die Sprache, ihre eigenen spirituellen oder religiösen Erfahrungen zu beschreiben und in ihren Erfahrungsschatz einzuordnen. Später fehlen ihnen das Wissen und das Verständnis für eine wichtige kulturelle Komponente unserer Gesellschaft.
In unserer heutigen multireligiösen Gesellschaft werden Heranwachsende früher oder später mit Religion konfrontiert. Ohne Wissen um die traditionelle christliche Religion laufen sie Gefahr, blind einer andern Religion anzuhängen.
So spielt zum Beispiel bei der Frage, warum Jugendliche oder junge Erwachsene in den Jihad ziehen, das Nichtwissen um das christliche Kulturgut eine grosse Rolle: Eine ungestillte Sehnsucht in ihnen kann sie überempfänglich machen für einen vermeintlich gottgewollten, ruhmreichen Weg, an dessen Ende das Paradies winkt. So ist der Religionsunterricht in der Schule nach wie vor wichtig.
Welche Möglichkeiten gibt es, Kinder altersgerecht mit komplexen religiösen und spirituellen Inhalten vertraut zu machen?
Ein empfohlener Einstieg ist, dass man sie bei ihrer Neugierde, bei ihren Wünschen und Sehnsüchten abholt und auf ihre Fragen und Gefühle eingeht. Im oberen Schulalter geht es bald um die Berufs- oder Schulwahl. An diese für die Jugendlichen lebenswichtige Frage nach der Zukunft lassen sich auch andere existentielle Fragen anknüpfen. Das Wichtigste bleibt aber die Verfügbarkeit der Eltern oder der Bezugsperson für das Gespräch mit den Heranwachsenden.
Gibt es typische Entwicklungsschritte im spirituellen und religiösen Denken eines jungen Menschen?
Ja, es gibt sie. Die Psychologen Fritz Oser und Paul Gmünder zum Beispiel konnten in Abhängigkeit vom Alter Stufen des religiösen Urteils finden: Vom kindlichen Glauben an absolute Fremdbestimmtheit bis zur Orientierung an universeller Kommunikation und Solidarität im Erwachsenenalter.
Umgekehrt meine ich, dass es bezüglich der Spiritualität keine festgelegte Entwicklung gibt. Kinder sind von Geburt an spirituell. Schon Kleinkinder können spirituelle Erfahrungen machen, die ihr Leben prägen. So hatte etwa Hildegard von Bingen bereits im dritten Lebensjahr eine mystische Erfahrung.
Werden Kinder, die heutzutage über Gott, Glaube und Religion reden, von den anderen nicht ausgelacht?
Für Kindergarten- und junge Schulkinder ist die Vorstellung, dass es Gott gibt, natürlich. Es sei denn, dass ihnen Erwachsene etwas anderes sagen, zum Beispiel, die Geschichte von Jesus Christus sei ein Märchen. Kinder unterhalten sich darüber so wie über ein anderes Thema, sie sind Philosophen.
Ältere Schulkinder hingegen stellen mit dem Einsetzen des logisch-abstrakten Denkens alles in Frage, so auch Glaubens- und Gottesvorstellungen. Wenn ein älteres Schulkind seine Glaubensüberzeugung lautstark verkündet, kann es sich dem Unverständnis der anderen Schülerinnen und Schüler aussetzen, ja gar gemobbt werden.
Wie lassen sich kindliche Gottesbilder charakterisieren?
Wir können die konkreten Gottesbilder im Kindesalter von den abstrakten im Jugendalter unterscheiden. Kinder stellen sich Gott bis ins Alter von circa 9 bis 11 Jahren konkret vor. Sie zeichnen Gott zum Beispiel in Menschengestalt als alten, bärtigen Mann oder verhüllt in einer Wolke. Jugendliche stellen sich Gott abstrakt vor, etwa in Gestalt des christlichen Kreuzes.
Auch denkerisch besteht ein Unterschied: Kinder denken sich Gott, je nach Erfahrung, als den, der Geborgenheit und Trost gibt, mit dem man ins Gespräch kommen kann. Oder als den, der alles sieht und straft. Jugendliche kennen viel eher den distanzierten Gott, der wohl da ist, aber nicht eingreift in das persönliche oder in das Weltgeschehen. Lebensbejahende Gottesvorstellungen wirken ausgleichend auf die seelisch-geistige Verfassung des Kindes.
Oft sorgt der Glaube an eine allmächtige Wesenheit auch für Ängste: Was läuft in solchen Fällen falsch?
Ob der Glaube an eine allmächtige Wesenheit Angst macht oder nicht, hängt davon ab, wie man diese gegenüber einem Kind charakterisiert. Gestalten, die für das Böse stehen, wie beispielsweise «die Bösen» in einem Game, wecken zwiespältige Gefühle: Einerseits werden Macht und Gewalt als faszinierend erlebt, anderseits machen sie Angst, weil man nicht weiss, wie damit umzugehen ist.
Ähnlich steht es mit den Gottesbildern: Gott, der von den Eltern dargestellt wird als einer, der alles sieht, ein strafender Gott, macht Angst. Solche von moralisierenden Vorstellungen geprägte Gottesbilder können seelische Krankheiten auslösen. So gilt es, Gottesbilder zu klären.