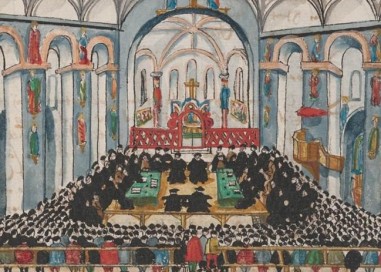Regen bestimmte das Wetter im Mai und Anfang Juni. Von Blitz und Donner begleitet, startete auch im Bubiker Ritterhaus die Premiere der Mittwochsgespräche zum Gedenkjahr 1816, zum «Jahr ohne Sommer». 1816 – das war nicht nur Hudelwetter, sondern todbringender Regen mit Schnee im Zürcher Oberland bis Ende Juni. 200 Tage Niederschläge liessen auf den Äckern Getreide und Kartoffeln verfaulen, verwandelten Rinder zu hungerleidenden Skeletten. Was es heisst, am Hungertuch zu nagen, zeigt die Ausstellung «Heisshunger und Schneesommer» im Ritterhaus. In Schälchen reihen sich dort Kartoffelschalen, Gras, aber auch Frösche und Mäuse auf – Armeleute-Kost in den Hungerjahren 1816 und 1817.
Hungerkrise
Und arm, mausarm, waren die Leute besonders im Zürcher Oberland. Zusammen mit den Ostschweizern waren sie von der Hungerkrise am stärksten betroffen. Die mechanisierten englischen Textilmanufakturen setzten den Handspinnern und Webern im Oberland zu. So kam zur weit grassierenden Arbeitslosigkeit noch der Hunger.
Warum aber die Sonne 1816 nicht scheinen wollte, wussten die Hungernden nicht, wie der Klimahistoriker Daniel Krämer herausstreicht. Für viele waren die modern aufkommenden Blitzableiter die Ursache für das Wetterchaos. Erst hundert Jahre später erkannte man die Ursache: Der gewaltige Ausbruch des Vulkans Tambora im heutigen Indonesien schleuderte solche Unmengen von Lava-Asche in die Atmosphäre, dass die Partikel die Sonneneinstrahlung blockierten und für drei Jahre eine planetarische Abkühlung auslösten. Vorstellungen von einer neuen Eiszeit spukten noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts herum.
Im Kontrast dazu ist heute indes die Klimaerwärmung das grosse Thema. Vor dem Hintergrund des meteorologisch scharfen Einschnitts 1815 fragt sich, ob sprunghafte Wetterkapriolen nicht die ganzen Szenarien der Klimaforschung über den Haufen werfen. Thomas Stocker, der renommierte Klimaforscher und Mitautor des Weltklimaberichts, zog gleich eingangs beim Mittwochabend-Gespräch einen Trennstrich zwischen Wetter und Klima. Das Wetter sei ein kurzfristiges, chaotisches Phänomen; das Klima hingegen dank global vernetzter Messwerte ein berechenbares System.
Die Gefahr der Erderwärmung, wie sie der Klimabericht mit grosser Wahrscheinlichkeit annimmt, sollte ernst genommen werden. Stocker appellierte an die Entscheidungsträger: «So wie jede Planung bis hinunter zur Gemeinde den Finanzierungsaspekt prüft, sollte jeder politische Entscheid auf seine Auswirkungen auf das Klima hin betrachtet werden.»
Klimaziel erreichbar
Der Berner Uniprofessor gab sich optimistisch. Intelligente Mobilität, Nullenergiehäuser sowie weniger Rodung des Regenwaldes könnten die global vereinbarten Klimaziele von einer Erderwärmung von nur zwei Grad möglich machen. «Was wir brauchen, ist eine vierte industrielle Revolution», sagte Stocker. Eine Wirtschaft, die auf fossilen Brennstoffen beruhe, sei selbst ein Fossil.
Welchen Beitrag denn der Einzelne leisten könne, fragte die SRF-Moderatorin Ladina Spiess-Defila den Klimaforscher. Zur Askese wollte er nicht aufrufen, aber weniger Autofahrten und Flüge könnten dem Einzelnen durchaus zugemutet werden, so Stocker.