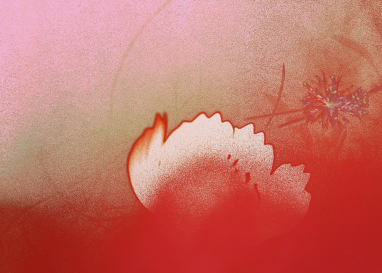Sie sind Spezialistin für Friedens- und Versöhnungsforschung. Wie erlebten Sie die gesellschaftliche Debatte während der Pandemie?
Ich beobachtete mit Besorgnis, wie der Ton immer rauer wurde. Selbst in unserem Dorf wurden im Vorfeld der Abstimmung zur Änderung des Covid-19-Gesetzes sowohl die Plakate der Befürworter als auch jene der Gegner mit teilweise wüsten Beschimpfungen versehen.
Sie haben sich in Ihrer Forschungsarbeit mit Spaltungen in der Gesellschaft auseinandergesetzt, unter anderem in Ruanda und Südafrika. Was sind typische Phänomene?
Ich bin vorsichtig, unterschiedliche soziale und geschichtliche Kontexte vorschnell miteinander zu vergleichen – dort Konflikte im Kontext eines Völkermords beziehungsweise der Apartheid, hier der Umgang mit der Pandemie. Und doch gibt es einige typische Merkmale gesellschaftlicher Spaltungen: der Umgang mit Stereotypen, die Rolle von Identitäten, von Selbst- und Fremdwahrnehmung, auch die Stigmatisierung der «Gegner» und die Erosion einer gemeinsamen Gesprächsbasis.
Statt einen Dialog zu führen, warfen sich die Konfliktparteien Intoleranz vor, wie das auch in den Erzählungen von Francesco B. und Daniel R. zum Ausdruck kommt.
Der Vorwurf der Intoleranz stand schnell im Raum. Diese Form von Beschwerde drückt im Grunde den Wunsch nach Wahrheit aus, was ja an sich ein positives Bedürfnis ist. Allerdings besteht jeweils die Gefahr, dass man die eigene Meinung, die eigene Wahrheit absolut setzt und letztlich das Interesse an anderen Meinungen verliert. Auf diese Weise kann das eigentlich Positive ins Negative rutschen. Gegenseitig schlägt man sich dann den Vorwurf der Intoleranz um die Ohren.
Wie lässt sich das verhindern?
Man müsste die verschiedenen Herangehensweisen an die Streitfragen anschauen und gemeinsam überlegen: Wo beissen sich unsere Überzeugungen und wo hingegen nicht? «Tolerare» heisst ja «mittragen», also auch solche Meinungen, von denen ich überzeugt bin, dass sie nicht richtig sind. Damit der Wunsch nach Toleranz erfüllt wird, müssen wir Ebenen gestalten, auf denen wir wieder miteinander ins Gespräch kommen können. Und vielleicht sind das erst mal Ebenen, wo man das Thema Corona weglässt. Das Leben besteht ja nicht nur aus einem Konfliktthema. Da kann es vorerst helfen, sich auf Themen zu konzentrieren, die einen miteinander verbinden.
Daniel schlug seiner Schwester vor, das Thema Impfen und Masken auszusparen, aber sie hält bis heute daran fest, dass er blind alles mitmache. Was könnte er tun?
Sind die Fronten verhärtet, aber beide Parteien haben trotzdem das Bedürfnis, wieder miteinander in eine Beziehung treten zu können, so wäre es eine Möglichkeit, eine dritte Person hinzuzuziehen. Dabei ist es weniger wichtig, dass diese Person neutral ist, sondern dass sie allparteilich ist. Diese Rolle könnte etwa ein Bekannter übernehmen oder auch eine externe Mediatorin.
Wie sieht es heute auf der gesellschaftlichen Ebene aus? Unser Eindruck ist: Corona und unser Umgang damit sind mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs versandet, doch die Gräben bestehen vielerorts weiter.
Ich sehe das ähnlich. Eine Krise hat die nächste abgelöst, aber die erste ist noch nicht vollständig bewältigt. Das ist nicht unproblematisch. Es ist wichtig, innezuhalten und zu reflektieren: Was ist seit Ausbruch der Pandemie eigentlich geschehen, und wie haben wir das gemeistert? Wo musste man aus der Notwendigkeit heraus handeln, bei welchen Massnahmen ist man aber vielleicht zu weit gegangen? Zur Kritik gehört auch die Selbstkritik.