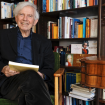Gerade die späten in Vulgärlatein und mit vielen Grammatik- und Rechtschreibfehlern verfassten Texte zeigten, dass die Flüche nicht von Angehörigen der Bildungselite stammten, sondern zur Alltagskultur der kleinen Leute zählten. «In den Gerechtigkeitsgebeten wird meist auch der Verlust von Alltagsgegenständen von geringem Wert beklagt», sagt Lau.
Dass die Flüche der «Welt der normalen Leute» entstammten, sei fürs Neue Testament besonders interessant. «Damit sind wir nahe am Alltag der frühen Christinnen und Christen und der Personen des Neuen Testaments, wie dem Apostel Paulus oder dem Ehepaar Priska und Aquila», so Lau. Insofern sei das Wissen um das Verfluchen in der Antike erhellend für einige Stellen des Lukasevangeliums, der Apostelgeschichte und der Briefe des Paulus, auch wenn Fluchtafeln nirgends direkt erwähnt würden.
Abstraktes wird konkret
So etwa die Stelle im sechsten Kapitel des Lukasevangeliums, wo es heisst: «Liebt eure Feinde; tut denen Gutes, die euch hassen! Segnet die, die euch verfluchen; betet für die, die euch beschimpfen! Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halt auch die andere hin und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd! Gib jedem, der dich bittet; und wenn dir jemand das Deine wegnimmt, verlang es nicht zurück!» (Lk 6,27–30)
Was zunächst abstrakt wirkt, wird konkret, wenn man die Fluchtafeln bedenkt. «Dass einem das Obergewand weggenommen wurde, kommt in den Gebeten um Gerechtigkeit vor», erläutert Markus Lau. Und auch die Möglichkeit, dass man verflucht wird, bedenke der Text.
Ein Ratschlag zum Überleben
Lukas stelle sich hier ganz im Sinne der Feindesliebe Jesu dagegen, in einer solchen Situation ein Fluchgebet auszusprechen und Fluch mit Fluch zu vergelten beziehungsweise auf erlebtes Unrecht mit einem Verbrechensfluch zu reagieren. Stattdessen fordere er zum Segnen auf. «Während man beim Fluchen jemandem Schlechtes wünscht, stellt das Segnen die Person unter den Schutz und in die Heilssphäre Gottes», sagt Lau. Damit gelinge es letztlich auch, die Logik der Gegenseitigkeit zu durchbrechen.
Hinter der Aufforderung stecke eigentlich ein Ratschlag zum Überleben. «Es ist eine Bewältigungsstrategie angesichts der Unrechtserfahrungen durch das römische Imperium, die die Leute in dieser Zeit machen mussten.» Indem sich jemand geradezu provokativ als hilflos zeige und sogar mehr tue, als der Peiniger verlange, komme der Peiniger ins Nach- und Umdenken.
Und so verschaffe auch das Segnen einem Opfer wieder Handlungsmacht. Vor dem Hintergrund der Fluchtafeln gelesen, merke man deutlicher, dass Lukas hier zu einer neuen kreativen Art des Umgangs mit dem Gegenüber auffordere, so Lau.
Fluchen tut gut
Davon, dass das Fluchen ursprünglich etwas mit dem Einbezug einer übermenschlichen Kraft zum Schaden Dritter zu tun hatte, seien heute nur noch Reste in unserer Sprache erhalten: Nämlich bei allem, was mit dem Wort «verdammen» zu tun hat, wie etwa «Gopfertami». Was die Antike sicher mit der Gegenwart verbinde, sei, dass das Fluchen der Person guttue, die es tue. Markus Lau formuliert es so: «Auch heute noch kann Fluchen punktuell entlastend wirken und dient als Bewältigungsstrategie für Situationen, in denen man sich sonst auf den ersten Blick kaum zu helfen weiss.»