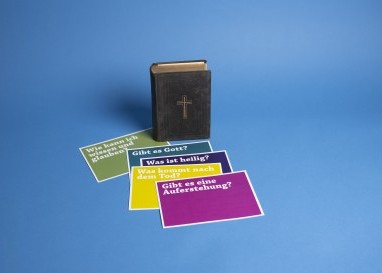Mitte Mai kam der Nahostkonflikt einmal mehr zum Ausbruch. Militante Palästinenser beschossen Israel mit Raketen, Israel schoss zurück. Die Gewalt entlud sich, weil palästinensische Familien in Ostjerusalem hätten enteignet werden sollen. Inzwischen gilt eigentlich Waffenruhe, aber bis Redaktionsschluss kam es zu neuen Vorfällen.
Die jüngsten Ereignisse zeigen einmal mehr, wie fragil die Lage in der Region schon seit Generationen ist.
Gewalt im Alltag und fehlende Empathie
Der Nahostkonflikt lässt sich nicht einfach erklären. Eine grosse Rolle spielen aber Gefühle. Sie hätten das Potenzial für positive Veränderungen, findet der Forscher Oliver Fink.
Am Checkpoint kommt es zu prägenden Erfahrungen. Foto: Reuters

Warum erzeugt Gewalt hier immer heftigere Gegengewalt? Der Politikwissenschaftler und Sozialpsychologe Oliver Fink von der Universität Basel liefert Erkenntnisse, die die herkömmlichen Erklärungsansätze neu beleuchten.
Ohnmacht im Alltag
Fink forscht zu Gruppenemotionen und ihrem Einfluss auf politisches Handeln. «Mich interessiert: Welche Gefühle führen zu welcher Art von politischem Handeln?», erklärt er. Der Nahostkonflikt eigne sich für dieses Forschungsfeld besonders. Deshalb lebte und arbeitete er während dreier Jahre in einer israelischen Ortschaft an der Grenze zum Westjordanland.
In seiner Forschung kam er zum Schluss, dass Menschen, die sich radikalisieren, oft von politischer Gewalt geprägt sind. Für eine Mutter in Palästina gehöre es etwa «zur Realität, dass sie sich überlegen muss, wie sie ihre Kinder auf eine eventuelle Hausdurchsuchung vorbereitet». Die durch Checkpoints eingeschränkte Bewegungsfreiheit trage auch zum Ohnmachtsgefühl der palästinensischen Bevölkerung bei.
Auf der israelischen Seite spiele dagegen die Angst vor dem Verlust
Angehöriger etwa durch den Militärdienst eine wichtige Rolle. Oliver
Fink spricht von einer «Infrastruktur des Konflikts», die sich aus
verschiedenen Komponenten wie Zonen, Militär, Checkpoints und
unterschiedlichen Rechtslagen zusammensetze. Das führe zwangsläufig zu
einer gereizten Grundstimmung. So brauche es nicht viel, um
Eskalationen in Gang zu setzen.
Eigentümliche Atmosphäre
Den Zorn und die Unruhen in Jerusalem im Zusammenhang mit dem jüngsten Konflikt hat Joachim Lenz hautnah miterlebt. Er ist seit August 2020 Propst der Erlöserkirche in Jerusalem und der erste evangelische Pfarrer in dieser Funktion. Während der Unruhen war er buchstäblich mittendrin: «Die Propstei liegt
exakt am Schnittpunkt von jüdischem, christlichem und muslimischem
Viertel.» So bekam er die Ausschreitungen am rund 500 Meter entfernten
Damaskustor unmittelbar mit. Selbst nach der Entspannung der Lage nahm er noch immer eine «eigentümliche Atmosphäre» wahr: «Längst nicht alle
trauen dem Waffenstillstand.» Durchaus zu Recht, wie sich in den
folgenden Tagen schnell zeigen sollte.
Propst Lenz erlebt seine Situation zwischen den Fronten nicht immer als einfach. Er tue sich schwer damit, dass die Leute nicht miteinander redeten: «Dass auch israelische Städte beschossen werden, nehmen viele in Palästina gar nicht wahr, umgekehrt reduzieren viele Israelis den palästinensischen Freiheitskampf auf Terrorakte.»
Dass Kontakte zwischen den beiden Gruppen fehlen, sagt auch Fink: «Der israelischen Zivilbevölkerung ist es verboten, in die palästinensischen Kerngebiete zu reisen.»
Ein breites Bündnis
Am 2. Juni verkündeten der Mittepolitiker Jair Lapid (Jesch Atid) und der national-religiöse Naftali Bennett (Jamina) ihre neue Regierungskoalition. Das Bündnis umfasst acht Parteien, darunter Linke, Mitteparteien, religiöse und säkulare Nationalisten sowie die Vereinigte Arabische Liste. Das Bündnis eint der Wille, eine weitere Amtszeit Netanjahus zu verhindern. Joachim Lenz, Propst der Erlöserkirche in Jerusalem, sieht in dieser neu gebildeten, wenn auch noch wackligen Regierungskoalition etwas Visionäres. Und auch ein Zeichen der Hoffnung. «Nur schon die Idee, so etwas zu versuchen, finde ich atemberaubend», sagt Lenz.
Palästinenser erleben Israelis meist als Soldaten oder Arbeitgeber bei Aushilfsjobs. Empathie könne so beidseits nicht entstehen. «Es braucht Begegnungsräume, wo man sich auf Augenhöhe gegenübersteht.» Empathie lasse sich nicht erzwingen, doch stecke grosses Potenzial in ihr. Positive Erfahrungen beeinflussten Emotionen relativ schnell. «Mit ihrer Hilfe lassen sich Veränderungen besser erzielen als über politische oder religiöse Einstellungen», ist Fink überzeugt.