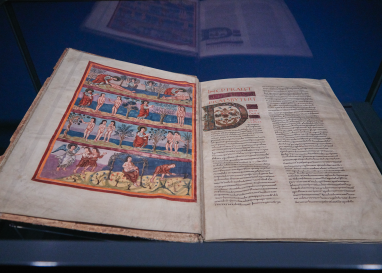Dennoch ziehen viele Täufer weg, in die Niederlande etwa oder auf die Jurahöhen, wo sie ausgerechnet vom katholischen Fürsten, dem Bischof von Basel, ausdrücklich geduldet werden, unter bestimmten Auflagen. Als der Jura nach dem Wiener Kongress 1815 dem Kanton Bern zugschlagen wird, kommen die Täufer wieder unter die Obhut ihrer alten Regierung. Diesmal aber geht es friedlich: Jetzt gilt Glaubensfreiheit.
Pioniere im Landbau
«Die Isolation auf den meist hoch gelegenen Höfen zwang die Täufer dazu, eigene neue Wege zu finden, wenn sie überleben wollten», berichtet die Erzählerin Magdalena Gurtner im Buch. Sie werden Pioniere in der Landwirtschaft, arbeiten hart und verbessern ihre Lebensbedingungen. Unter ihrem Einfluss wird das Freiberger Pferd zum berühmten Arbeits- und Freizeitpferd, sie züchten das Jura-Schaf und erweisen sich als treffliche Halter der Simmentaler Kuh. Sie organisieren die Schulbildung selber und kennen sich in der Heilkunde aus.
Das Buch berichtet auch Überraschendes. Gemeinhin gelten die Täufer oder Mennoniten, wie sie sich heute nennen, als Pazifisten. Das trifft aber nicht auf alle zu. Nebst den friedliebenden «Stäblern» gab und gibt es die wehrhaften «Schwertler». Zum Beispiel den Kavallerie-Major David Gerber, der während des Zweiten Weltkriegs zum Offiziersbund gehörte. Dessen Mitglieder wollten die Regierung stürzen, falls die Schweiz 1940 den Nazis nachgegeben hätte, und ihr Land bis zum Äussersten verteidigen.
Der Bund flog auf, aber General Henri Guisan bestrafte die Verschwörer nur milde. Gerber kam mit einem Verweis davon.
Den Forscherdrang anregen
All dies und noch viel mehr hat auf den 70 Seiten des eher heftförmig angelegten Buches Platz, zum Beispiel auch die Bereiche Mission, Kultur, Öffnung gegenüber der Welt und die Frauenfrage. Die Breite des Themas und der Wunsch nach einer gewissen Vollständigkeit macht Verkürzungen unumgänglich. Entsprechend werden mache Dinge im Buch mehr angetönt denn restlos erklärt, was dem Werk aber wenig Abbruch tut, denn letztlich will es kein akademisches Kompendium sein, sondern das allgemeine Interesse wecken und zu vertieftem Nachfragen und Nachforschen anregen.