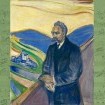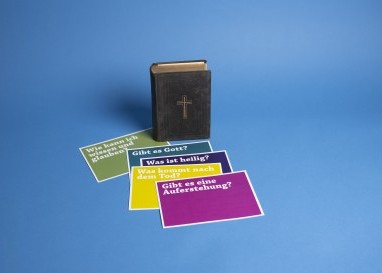101 Jahre alt, Zustand fragil, kaum mehr transportfähig und herzeigbar. Dieser vergilbte goldene Engel von Paul Klee hat etwas Sonderbares an sich. Unter der lockigen Mähne ein fast löwenartiges Antlitz, der Kopf wirkt überdimensioniert im Vergleich zum Rest des Körpers; flächig-fein die (noch) kleinen Flügel mit fünffingrigen Enden sind erhoben, wie zum Segen ausgebreitet. Oder Einhalt gebietend: Stopp?
Ein in die Jahre gekommener Babyengel mit Löwenhaupt und einem filigranen Vogelköper, der einem dieser Origami-Kraniche ähnelt: Paul Klees «Angelus Novus», ein neuer oder eben neugeborener Engel, ist nicht nur einer der bekanntesten Gottesboten der Kunstgeschichte, sondern auch einer mit mächtiger Ausstrahlung und Wirkungsgeschichte. Viele haben ihn beschrieben und bedichtet, allen voran Walter Benjamin (1892 bis 1940), der ihn vor 100 Jahren erstand und ihn sich in Berlin übers Sofa hängte. Benjamin liess den Engel im Lauf seines Lebens immer wieder in seinen Texten erscheinen, und der «Angelus Novus» sollte sein wertvollster Besitz werden.