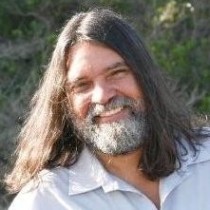Desmond Tutu war ein tief spiritueller Mensch. Täglich nahm er sich Zeit für Stille und Gebet. Das unterschied ihn von den meisten anderen Führungspersönlichkeiten in Südafrika, selbst von Nelson Mandela.
Der anglikanische Erzbischof liess sich nie von Machtkämpfen, politischem Kalkül oder der Masse beeinflussen. Wurden er oder andere mit dem Tod bedroht, blieb er ruhig und konzentrierte sich darauf, zu helfen. Er wollte immer für alle Kinder Gottes da sein.