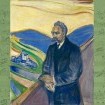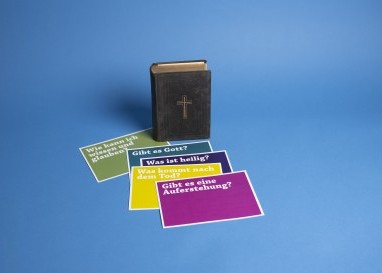Im demokratischen Zusammenleben kommt es oft zu Situationen, in denen Mehrheiten über Minderheiten entscheiden. Das sorgt für ordentlich Zündstoff, besonders in Ländern mit ethnischen Minderheiten. Damit es keine Konflikte gibt, sollten Minderheiten etwa in die Gesetzgebung eingebunden sein. Wie dies jedoch konkret gelingen kann und wo Schwierigkeiten lauern, zeigt die Arbeit von Andreas Juon auf. Er forscht in der Gruppe für internationale Konfliktforschung der ETH-Zürich. Der Politikwissenschaftler vergleicht verschiedene Formen der Machtteilung und fragt, wie zufrieden die jeweiligen Minderheiten damit sind.
Zwei Arten der Machtteilung
Dabei unterscheidet er zwei Arten der Machtteilung: korporatistische und liberale. Beide Varianten haben das Ziel, Minderheiten in der Regierung und bei politischen Entscheidungen einzubeziehen. «Korporatistische Machtteilung tut dies mit direkten Mitteln, die explizit auf ethnische Minderheiten abzielen», erklärt Juon. Länder mit einer solchen Machtteilung setzen etwa auf Quoten für ethnische Minderheiten in Parlament und Regierung oder mit Vetorechten. Dies ist beispielsweise in Bosnien und dem Libanon der Fall.