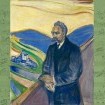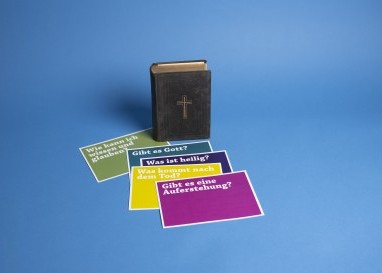Frau Schlatter, Sie waren Mitinitiantin zur Einführung der Mutterschaftsbeiträge 1991. Jetzt sollen diese abgeschafft werden. Was sagen Sie dazu?
Rita Schlatter: Es ist unsozial und
ungerecht. Den Müttern und Vätern hilft das sicher nicht.
Frau Zinsstag, wie denken Sie darüber?
Evelyne Zinsstag: Ich kannte das Modell bisher nicht. Doch das Beispiel der Mutterschaftsbeiträge, wie es Graubünden handhabt, ist geradezu avantgardistisch. Hiermit wird eine Art Elternzeit ermöglicht für schlecht verdienende Paare.
Warum haben Sie sich damals für die Einführung der Mutterschaftsbeiträge starkgemacht?
Schlatter: Als Geschäftsführerin der Familienberatungsstelle Adebar beriet ich viele Frauen, die verzweifelt waren, weil die bevorstehende Geburt sie in finanzielle Not brachte. Als Familienberatungsstelle hatten wir ja auch den Auftrag vom Kanton, Familien diesbezüglich zu unterstützen. Als ein Grossratsmitglied den Mutterschaftsbeitrag 1989 erstmals zur Diskussion brachte, dachte ich: Genau darauf warten wir schon lange. Ich rief sofort Heidi Derungs, eine befreundete Politikerin, an, und wir erarbeiteten kurzfristig eine Botschaft für das Parlament. Die Regierung war dagegen, das Parlament dafür, wie auch das Volk, das dem Gesetz über die Mutterschaftsbeiträge 1991 zustimmte. Dieser Erfolg ist auch das Verdienst der Zusammenarbeit der Frauenverbände im Kanton Graubünden.
Wem galten die Beiträge?
Schlatter: Müttern und Vätern, die sich aufgrund der Schwangerschaft in einer schwierigen finanziellen Situation befanden. Das Ziel war, dass die Eltern oder Alleinerziehenden den Entscheid, das Kind zu behalten oder nicht, selber fällen können. Der Entscheid sollte nicht von finanzieller Not beeinflusst sein. Das betraf die 17-jährige Gymnasiastin aus gutem Haus genauso wie die Alleinerziehende, die in prekären Verhältnissen lebte.
Wie viele Gesuche gingen damals bei Ihnen ein?
Schlatter: Im ersten Jahr war es nur eine Handvoll. Heute betrifft es bei zwanzig Geburten eine Frau.
Die Bündner Regierung sagt, das Modell der Mutterschaftsbeiträge entspreche nicht den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft, weil es die Frauen vom Arbeiten abhalte.
Zinsstag: Persönlich bin ich vier Monate nach der Geburt meines ersten Kindes wieder arbeiten gegangen. Für mich ging das gut, da ich Teilzeit arbeite, fünfzig Prozent. Aber für Frauen, die sofort wieder zu hundert Prozent arbeiten müssen, kann das zu früh sein. Die meisten Paare in meinem Umfeld sind akademisch gebildet und in relativ gut dotierten Stellen. Oft leisten sie sich nach dem Mutterschaftsurlaub noch einen unbezahlten Urlaub, um beim Kind daheim zu bleiben, weil es keine Elternzeit gibt. Das zeigt, dass ein grosses Bedürfnis da ist, mehr Zeit mit dem Neugeborenen zu verbringen, als es der Staat vorsieht. Deshalb unterstützt der Vorstand der Evangelischen Frauen Schweiz den Vorschlag der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen. Er beinhaltet eine flexibel einteilbare Elternzeit von 24 Wochen. Ich selber fände das Modell aus Deutschland sinnvoll, bei dem der Mutterschutz sechs Wochen vor dem Geburtstermin beginnt.
Schlatter: Natürlich wollen viele Frauen beides verbinden: Kind und Arbeit. Aber gerade für junge Mütter und Väter kann eine unverhoffte Schwangerschaft zu kurzfristigen finanziellen Engpässen führen. Da setzen Mutterschaftsbeiträge unkompliziert an. Sie sind ebenfalls eine Wertschätzung an die Eltern, auch wenn sie durch eine Schwangerschaft in Not geraten sind.
Die Regierung will die Beiträge auch nicht abschaffen, sondern in die Sozialhilfe integrieren. Was ist schlecht daran?
Schlatter: Viele, die Mutterschaftsbeiträge beziehen, sind nicht sozialhilfeberechtigt. Es betrifft vor allem Frauen, die ungewollt schwanger wurden, die eine Arbeit oder Lehrstelle haben, sich aber aufgrund der Schwangerschaft neu orientieren müssen. Sie können sich keinen unbezahlten Urlaub leisten, um die erste Zeit beim Kind zu bleiben, oder der Arbeitgeber gewährt ihnen keinen. Das betrifft auch Lehrlinge, die aufgrund der Schwangerschaft einen Unterbruch machen wollen. Fallen die Mutterschaftsbeiträge weg, werden einfach die Gemeinden höhere Kosten haben.
Zinsstag: Das sehe ich auch so. Das Argument, die Mutterschaftsbeiträge abzuschaffen und dafür die externe Kinderbetreuung auszubauen, halte ich für ein Feigenblatt. Es ist eine Umschichtung des Geldes und stellt daher keine Mehrinvestition in die Unterstützung für die Familien dar. Den Mutterschutz und die Kinderbetreuung gegeneinander auszuspielen, halte ich für falsch. Meiner Meinung nach müsste die Politik die Mutterschaftsbeiträge ausbauen und weiter in die Kinderbetreuung investieren.
Wie beurteilen Sie die Familienpolitik in der Schweiz grundsätzlich?
Zinsstag: Die Schweiz ist diesbezüglich ein konservatives Land. Familienpolitische Entwicklungen brauchen hier viel länger als anderswo. Das liegt wohl nicht zuletzt am basisdemokratischen Verständnis der Schweizerinnen und Schweizer. Es hat aber auch den Vorteil, dass die Akzeptanz höher ist, wenn die Bevölkerung einmal einer Sache zugestimmt hat. Früher oder später werden wir eine Elternzeit auch in der Schweiz haben.
Schlatter: Das Bündner Volk respektive der Grosse Rat hat schon einmal für die Mutterschaftsbeiträge gestimmt, jetzt lässt er sie sich wieder wegnehmen. Optimieren auf Kosten junger Familien, das entspricht nicht den Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft.