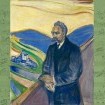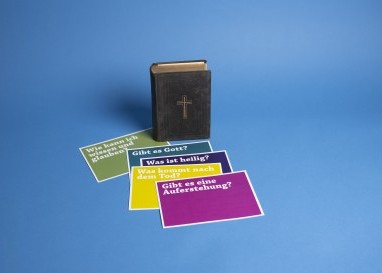Die deutsche Botschafterin des Reformationsjubiläums, Margot Kässmann, sprach es 2012 im Interview mit «reformiert.» klar aus: «Luther hat furchtbare Dinge über das Judentum gesagt, hier hat er schrecklich versagt.» Entsprechend soll auf das Reformationsjubiläum 2017 hin ein «gebrochenes Bild» des Reformators gezeichnet werden.
Dieser Ansatz ist mit Blick auf die Entwicklung, die Martin Luthers Einstellung zum Judentum genommen hat, nötig. Anfänglich stand er den Juden positiv gegenüber. In seiner Schrift «Dass Jesus ein geborener Jude sei» von 1523 übte Luther Kritik an der damals verbreiteten Dämonisierung des Judentums und machte sich für eine Politik der Duldung der Juden stark, plädierte für Toleranz.
Und dies, obwohl Luther aus theologischer Sicht das Judentum grundsätzlich ablehnte. Zentral war für ihn, dass die Juden Jesus nicht als Messias anerkannten und auch nicht mit ihm übereinstimmten in der Überzeugung, dass der Mensch allein durch Gnade und nicht aufgrund seiner Werke gerettet werde. Luther sah die Juden unter Gottes Zorn, als verworfenes Volk. Dennoch war selbst seine Schrift von 1523 sehr judenfreundlich abgefasst. Er hoffte damals, viele Juden für das Christentum und speziell für seine reformatorische Bewegung mit ihrer Wiederentdeckung des Evangeliums gewinnen zu können.
Hass aus Enttäuschung. Diese Hoffnung zerschlug sich in den folgenden Jahren. Damit schlug Luthers Einstellung zum Judentum in blanke Ablehnung um. 1538 erschien das Pamphlet «Wider die Sabbather», 1543 folgte «Von den Juden und ihren Lügen». Nun sprach der reine Hass aus seinen Schriften, die stellenweise gar in die Fäkalsprache abglitten. Er unterstellte den Juden mörderische Absichten gegen Christen, wollte sie dem geltenden Ketzerrecht unterstellen, forderte ihre Vertreibung aus protestantischen Gebieten. Luther wollte die Juden entrechten, ihnen sogar die Religionsausübung verbieten; man solle deren Synagogen und Häuser abbrennen oder mit Erde zuschütten.
Die Enttäuschung Luthers, die Juden nicht «bekehren» zu können, war riesig. Er war überzeugt, sie hätten sein Wohlwollen missbraucht, und warf ihnen vor, «Jesus geschmäht» zu haben. Luther hatte kaum je direkten Kontakt mit Juden. Seine ungemein scharfe Polemik hing wohl auch mit seinem Charakter zusammen, wie Peter Opitz, Professor für Kirchen- und Dogmengschichte an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, sagt: «Luther konnte in seinen Schriften die frohe Botschaft zum Leuchten bringen. Um sie ging es ja in der Reformation, und um sie soll es auch im Reformationsjubiläum gehen. Luther konnte aber auch grob polemisieren, nicht nur gegen Juden, sondern ebenso gegen aufständische Bauern, den Papst, die Türken und die Schweizer Reformatoren, die seiner Abendmahlslehre widersprachen.»
Leider keine Ausnahme. Luther stand mit seinen Ressentiments gegen die Juden nicht allein da. Opitz verweist auf die antijüdische Stimmung, die sich durch die Geschichte des Christentums zieht. Zwingend war diese aber keineswegs. «Wolfgang Capito aus Strassburg, der sich etwa für das Wohnrecht der Juden einsetzte, zeigt, dass man auch als Reformator zu jener Zeit durchaus judenfreundlich eingestellt sein konnte.»
Fatale Wirkungsgeschichte. In der Schweiz waren die Juden zur Zeit der Reformation kein Diskussionsthema. Zwingli setzte sich nie direkt mit ihnen auseinander. Sein Nachfolger in Zürich, Heinrich Bullinger, war schockiert über Luthers polemischen Antijudaismus. Doch riet auch er in einem Gutachten für die Stadt Augsburg, die Juden nicht vor Ort zu dulden, da deren Anwesenheit einfache Christen verunsichern könnte. Auch würden die Juden in ihren Gebeten gegen die christliche Religion lästern.
Stark diskutiert wird heute, wie weit Luthers Judenhass den deutschen Antisemitismus befeuerte. Ein Unterschied ist, dass es für den Reformator stets um Glaubensfragen ging, Antisemiten hingegen seit dem 19. Jahrhundert die Juden als «Rasse» bekämpften. Doch, so schreibt auch das Luther-Lexikon von 2014, konnte der Antisemitismus in Nazideutschland «an Luthers dämonisierendem Feindbild und die Agitation zur Gewalt» anknüpfen.