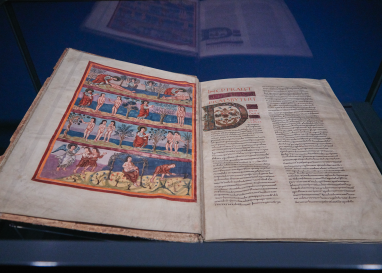Auch Thriller können Tiefgang haben. Dan Brown, in diesem Genre sehr erfolgreich, setzt sich gerne mit wissenschaftlichen, kulturhistorischen und religiösen Fragen auseinander. In seinem neuesten Opus, dem Roman «Origin», geht es um die – vemeintliche – Gegensätzlichkeit von Glaube und Wissenschaft. Ein aktuelles Thema: Zunehmend sehen sich religiöse Menschen gegenüber ihren atheistischen, nur auf den eigenen Verstand bauenden Zeitgenossen dem Verdacht ausgesetzt, unaufgeklärt, ewiggestrig, märchengläubig und verblendet zu sein.
Die zwei grossen Fragen
Die Rolle des Atheisten weist Dan Brown dem jungen, sympathischen, weltweit vernetzten, erfolgreichen und entsprechend reichen Computerentwickler und Futurologen Edmond Kirsch zu. Dieser hat einen Quantencomputer entwickelt, der ihm nahezu unbegrenzte Rechenleistung liefert – sowie die Antworten auf zwei essenzielle Fragen der Menschheit: Woher kommen wir? Wohin gehen wir?
Nun – der Computer, eine Künstliche Intelligenz namens Winston, kommt zu Schlüssen, zu denen ein Computerhirn fast zwangsläufig kommen muss: Wir stammen nicht von einem Schöpfergott, sondern von Vater Zufall ab, und unaufhaltsam gehen wir in eine Zukunft, in der wir als elektronisch hochgerüstete, gottähnliche Wesen über ein technologisches Paradies gebieten werden. Doch nach all dem Temporeichen, Verwirrenden und Mörderischen, das sich über die 670 Buchseiten abspielt, gelingt es dem Autor am Schluss, Religion und Wissenschaft miteinander zu versöhnen.
Religion als Aberglaube
Dan Brown bringt auf den Punkt, was Atheisten am religiösen Denken irritiert. «Glaube bedeutet, etwas als Tatsache zu akzeptieren, für das es keine empirischen Beweise gibt», lässt er sein Computergenie vor grossem Publikum dozieren. Die Antithese dieses rückständigen Denkens sei die Wissenschaft. «Sie ist ihrer Definition nach der Versuch, physische Beweise für das Unbekannte, Unbewiesene zu finden und Aberglauben und Sinnestäuschungen zugunsten beobachtbarer Fakten zurückzudrängen.» Kirsch endet, bevor er von einem religiösen Fanatiker vor laufender Kamera liquidiert wird, mit den pathetischen Worten: «Das Zeitalter der Religion neigt sich dem Ende zu. Das Zeitalter der Wissenschaft hat aber gerade erst begonnen.»
Für gläubige Menschen nicht gerade eine Frohbotschaft. Doch da ist auch noch der Geisteswissenschaftler Robert Langdon. Er muss herausfinden, warum und von wem sein Freund Kirsch ermordet wurde; Antworten bekommt er im Zuge eines furiosen Showdowns in der berühmten Kathedrale Sagrada Familia in Barcelona. Dabei erfährt er auch, dass Kirsch gar nicht der hartgesottene Atheist war, als der er sich immer gegeben hatte.
So endet denn der Roman, der mit einem Plädoyer für den wissenschaftsgläubigen Atheismus begonnen hatte, mit einem versöhnlichen Brückenschlag zwischen Gott und Wissenschaft. Der Priester in der Sagrada Familia fasst es in einem Satz zusammen: «Es hat noch niemals einen intellektuellen Fortschritt gegeben, der Gott nicht eingeschlossen hätte.»