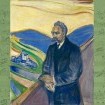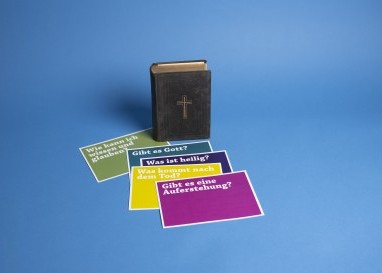Kurz vor Lehrabschluss als Verkäuferin zeigte sich, dass sie die schulischen Fächer nicht bestehen würde, erzählt Ruth Merz (Name geändert). Deshalb habe der Lehrmeister eine Abklärung verlangt. Diese zeigte, dass ihr Defizit in Lesen und Schreiben zu gross war, um die Abschlussprüfung erfolgreich zu absolvieren. «Dabei hatte ich die Lehrstelle nach dem Kriterium gewählt, dass man in diesem Beruf nicht viel schreiben muss», so die heute 50-Jährige.
Leseschwäche trotz Schulbildung
Ruth Merz ist eine von 800 000 Menschen in der Schweiz, die trotz Schulbildung nicht so gut lesen und schreiben können, wie es im Beruf und Alltag gefordert und erwartet wird. «Warum die Leute durch die Maschen fallen und ihre Schwäche bis ins Erwachsenenalter unentdeckt bleibt, hat verschiedene Ursachen», meint Brigitte Aschwanden, Projektkoordinatorin im Schweizer Dachverband Lesen und Schreiben. Aber es sei einfach eine Tatsache, und die neuesten Zahlen der Pisa-Studie zeigten keine Besserung.
Kampf mit den Buchstaben
«Illetrismus ist ein weit verbreitetes Problem, das in unserer Gesellschaft kaum wahrgenommen wird.» Die Betroffenen haben meist gut funktionierende Vermeidungsstrategien entwickelt, damit ihr Defizit nicht auffällt. Dazu kommen die Scham und die Überzeugung, alle anderen hätten in diesem Bereich kein Problem. «Erst als ich einen Kurs im Verein Lesen und Schreiben Bern besuchte, merkte ich, dass ich nicht die Einzige bin, für die Lesen harte Arbeit ist», sagt Ruth Merz. Eine Arbeitskollegin habe sie auf das Angebot hingewiesen. «Da ich vorher weder Zeitung noch Werbeplakate oder sonst irgendwas freiwillig las, wusste ich nicht, wie viele Erwachsene mit Buchstaben kämpfen.»
Grosser Leidensdruck
Dieses Beispiel zeige deutlich: mangelnde Lesekompetenzen erschwere es den Menschen, am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen sowie am kulturellen Leben teilzuhaben, sagt Aschwanden. «Der Leidensdruck ist riesig. Und in den Schulen und Betrieben fehlt oft die Zeit – oder das Bewusstsein, dass man genau hinschauen muss, ob jemand wirklich über die erwartbaren Grundkompetenzen verfügt.»
In den Kursen, die der Verein Lesen und Schreiben anbietet, zeige sich auch, wie individuell jeder einzelne Fall sei. «Wer zu uns kommt, wird erstmal in dem unterstützt, was er oder sie bereits kann.» Das wachsende Selbstvertrauen ermögliche es dann, Blockaden abzubauen und sich Texten und Zahlen zu stellen. Das brauche alles viel Zeit, betont Brigitte Aschwanden. Wichtig sei auch, dass die Gesellschaft verstehe: Menschen, die nicht genügend Sprachkompetenzen haben, sind weder faul noch dumm. «Bildung ist leider auch hierzulande immer noch Glückssache, und wer Pech hatte, benötigt Unterstützung.» Katharina Kilchenmann
www.lesenschreiben-d.ch