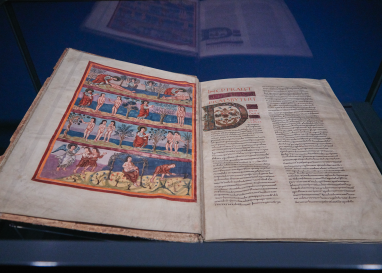Markus Noll war sieben Jahre alt, als der Schularzt einen Schatten auf seiner Lunge entdeckte. In den folgenden Wochen fühlte er sich ein bisschen müder als sonst. Als die Eltern eine leicht erhöhte Temperatur feststellten, schrillten die Alarmglocken. Tuberkulose lautete die Diagnose. Und die einzige Behandlung damals: Höhenkur. Am besten in Davos.
Der Erstklässler verbrachte 1952 ein halbes Jahr im Friedberg. Das Sanatorium in Davos hatte sich auf die Behandlung von Kindern spezialisiert. «Wichtig war den Krankenschwestern und Diakonissen immer, dass wir genug assen», sagt Markus Noll heute. Neben den Tellern, die leer gegessen werden mussten, gehörten das Liegen an der frischen Berg-luft und regelmässige Spaziergänge zur Therapie. Nach der Rückkehr ins Pfarrhaus von Arlesheim, wo Markus Noll als jüngstes von acht Geschwistern aufwuchs, galt er als geheilt.
Der Pionier aus Preussen. Wirkte die frische Bergluft Wunder? Mit der Frage beschäftigte sich der inzwischen emeritierte Professor für Molekularbiologie nicht. Bis ihn Christian Schürer kontaktierte. Der Historiker widerlegt den Mythos von der Heilkraft der Berge in seiner Dissertation. Noll fühlte sich bestätigt statt überrascht. «Dass eine bakterielle Krankheit durch Umwelteinflüsse geheilt werden könnte, ist für mich als Biologe eine abenteuerliche These.» Tuberkulose war in der Familie allgegenwärtig. Ein Bruder musste mehrmals nach Davos, die Schwester infizierte sich als Krankenpflegerin in Montana und musste sich einen Lungenflügel entfernen lassen.
Bevor Tuberkulose mit Streptomycin behandelt werden konnte, galt die Höhenkur als beste Therapie gegen die Krankheit. 1952 erhielt Selman Waksman den Nobelpreis für die Entdeckung des Antibiotikums. In Mitteleuropa befand sich die Krankheit dank besserer Hygiene bereits auf dem Rückzug.
Prachtpaläste im immunen Klima. Damit endete die Blütezeit eines Medizintourismus, der seinen Wegbereiter im fernen und recht flachen Preussen hatte: Hermann Brehmer (1826–1889) hatte die Kaltwasserheilanstalt von Gröbersdorf im heutigen Polen in ein Sanatorium für Tuberkulosepatienten verwandelt. «Prachtspaläste und Villen» entstanden, Brehmer schrieb dank dem «immunen Klima» auf 560 Metern über Meer eine «atemberaubende» Erfolgsgeschichte, die Schürer detailliert schildert. Bald wollten Studien zeigen, dass auf Meereshöhe am meisten Menschen an Tuberkulose litten und ihre Zahl mit den Höhenmetern sinke. In Europa gebe es wenige tuberkulosefreie Lagen. Oben auf der Liste: das Engadin und Davos.
Im Dienst der Propaganda. Für die strukturschwachen Berggebiete waren die Forschungsarbeiten eine Chance. Insbesondere deutsche Forscher, Geschäftleute und Ärzte, die häufig wegen kranken Angehörigen in die Schweiz kamen, bauten ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Höhenkliniken auf. Die Höhenkur wurde zum Wirtschaftsfaktor. 1922 wurde das Institut für Hochgebirgphysiologie und Tuberkuloseforschung gegründet. Mit dem expliziten Auftrag, wissenschaftliche Belege für die Heilwirkung des Hochgebirges zu finden.
Schürer schreibt, das erklärte Ziel der Davoser Ärzte und Behörden sei «Propaganda» für die Höhenkur gewesen, um «auch das wirtschaftliche Gedeihen der Kurindustrie zu fördern». Er zeichnet in seinem sorgfältig recherchierten und klug argumentierenden Buch nach, wie ein Mythos verwissenschaftlicht werden konnte: «Indem Ärzte und Wissenschaftler die heilsame Wirkung des Höhenklimas bei Tuberkulose kontinuierlich beschrieben, verhalfen sie der Höhenbehandlung zum Durchbruch und hielten den Traum von Heilung im Hochgebirge lebendig. Sie legten dabei nicht eine na-türliche Heilkraft des Gebirges frei, sondern machten diese heilende Wirkung durch ihre Texte wahr.»
Höhenkur und Tamiflu. Für den Zeitzeugen Markus Noll ist das Buch ein Lehrstück für interessengesteuerte Forschung in der Medizin. Mit Blick auf heute: «Ob das Grippemedikament Tamiflu wirklich hilft, ist umstritten, doch mit Sicherheit war es ein gutes Geschäft.» Und natürlich kehrten einst viele Tuberkulosepatienten, die im Frühstadium der Krankheit nach Davos geschickt wurden, gesund zurück. Viel Ruhe, gute Luft und gutes Essen stärken das Immunsystem. Egal ob im Flachland oder in den Bergen.
Das hatte eine prominente Tuberkulosepatientin bereits vor hundert Jahren geahnt: «Wissen Sie, das Klima hier ist sehr gut gegen die Krankheit, unter Umständen ist es aber auch gut für die Krankheit», zitiert Katia Mann den Leiter des Waldsanatoriums Davos in ihren «Ungeschriebenen Memoiren». Der Arzt wurde zum realen Vorbild für den Hofrat Behrens, den Thomas Mann in seinem Roman «Zauberberg» schuf. Die literarische Entzauberung des Mythos wiederum inspirierte Christian Schürer für seine wissenschaftliche Arbeit.
Christian Schürer: Der Traum von Heilung. Eine Geschichte der Höhenkur zur Behandlung der Lungentuberkulose. Hier und Jetzt, Baden 2017