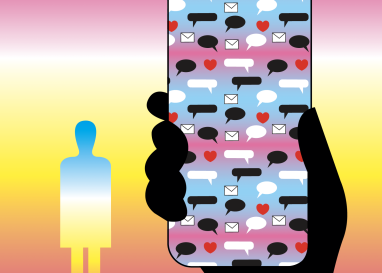Hanna Wüthrich wird als Braille-Lehrerin an der Blindenschule im bernischen Zollikofen bald pensioniert. Seit ihrer Geburt ist sie vollständig blind. So bedeutet denn das Wahrnehmen mit den Händen, den Fingern und vor allem den Fingerbeeren für die Schaffhauserin quasi das Leben.
Sie macht es nicht nur selbst, sondern hat während Jahrzehnten ungezählte Menschen vom Kleinkind- bis ins Erwachsenenalter dabei unterstützt, es zu lernen. Sie sagt: «Den Tastsinn zu schulen, ist enorm wichtig. Und es ist auch die grösste Knochenarbeit. Dafür muss man üben, üben, üben.»