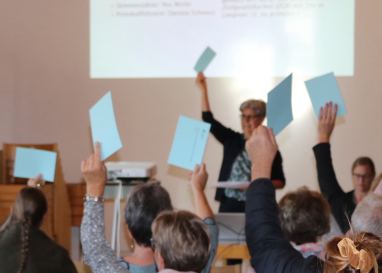Wohl keine Kirche im Emmental ist bekannter als das Würzbrunnen-Kirchlein. Das eher kleine, aber markante Bauwerk steht allein auf einer grossen, flachen, von Wald gesäumten Wiese ob dem Dorf Röthenbach, das unten im Tal über ein zweites Gotteshaus verfügt. Die Kirche Würzbrunnen gilt als die Mutterkirche des Emmentals und hat durch die Gotthelf-Verfilmungen des Burgdorfer Regisseurs Franz Schnyder (1910–1993) nationale Bekanntheit erlangt, die bis heute andauert. Entsprechend handelt es sich um eine der beliebtesten Hochzeitskirchen im Kanton Bern und darüber hinaus.
Es ist Frühsommer und die Saison der Vermählungen in vollem Gang. Für die Reservationen zuständig ist Sabine Engel. Sie hat eine tiefe persönliche Beziehung zu diesem kulturhistorisch bedeutsamen Bau. «Wenn ich einmal ein bisschen Ruhe brauche, sitze in die Kirche und tanke Kraft», erzählt sie. «Es ist für mich ein sehr besonderer Ort, ein richtiger Kraftort.» Beim Planen und Errichten dieser Gebäude sei in alten Zeiten oft ein Wissen eingeflossen, von dem heutige Menschen keine Ahnung mehr hätten. Vielleicht sei das ja mit ein Grund, weshalb das Kirchlein eine solche Ausstrahlung habe und sich immer wieder Menschen für eine Hochzeit in Würzbrunnen entschieden.