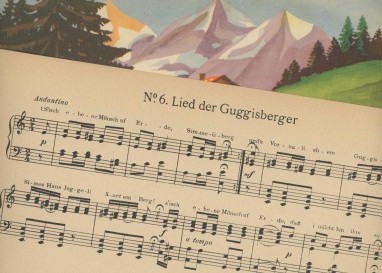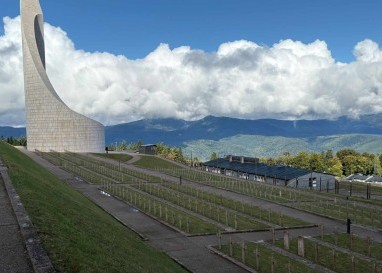Das Massaker der Hamas und der Start von Israels Offensive im Gazastreifen liegen sieben Monate zurück. Sie leben in Jerusalem. Was hat sich für Sie selbst verändert?
Hakam Awad: Das Gefühl von Sicherheit ist verloren gegangen. Anfangs trauten sich die Menschen kaum auf die Strasse. Auch die Bewegungsfreiheit ist seit dem 7. Oktober 2023 eingeschränkt, es ist schwieriger, von Ost- nach Westjerusalem zu gelangen. Und ich sorge mich ständig um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die unserer Partnerorganisationen im Gazastreifen.
Wir sprechen, eine Woche nachdem Israel Evakuierungen in Rafah angeordnet hat. Viele Hilfsorganisationen waren dort aktiv. Was bedeuten die Evakuierungen für Sie?
Wir erreichen unsere Räume in Rafah nicht mehr, daher mussten wir uns neu organisieren. Im Osten der Stadt waren unsere Partnerorganisationen gezwungen, die Arbeit weitgehend einzustellen. Eines unserer Teammitglieder lebte in Rafah und musste sich in Sicherheit bringen. Alle unsere drei Mitarbeitenden, die im Gazastreifen wohnten, haben ihre Häuser verlassen, sie leben jetzt in Flüchtlingsunterkünften im Süden oder fanden bei Verwandten Unterschlupf.