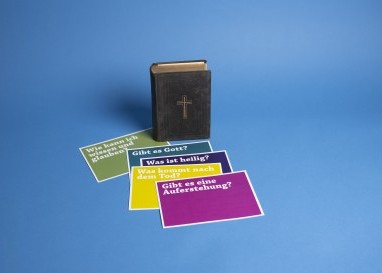«Peace line» wird die Mauer in Belfast genannt, doch von Frieden ist in Nordirland wenig zu spüren. In den vergangenen Wochen ist der Konflikt zwischen dem probritisch-protestantischen und dem irisch-katholischen Lager neu entbrannt.
Anfang April zündeten Jugendliche beider konfessionellen Lager in Belfast mehrere Nächte hintereinander Autos an, warfen Molotowcocktails über die Friedensmauern, attackierten Polizisten. Zum ersten Mal seit bald zehn Jahren kam es in der britischen Provinz Nordirland wieder zu Gewaltausbrüchen.