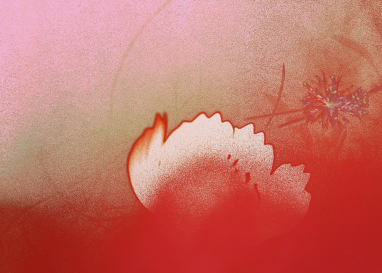Die «Cost of living crisis» trifft die Church of Scotland in einem ungünstigen Moment. Denn die schottischen Reformierten sind derzeit mit dem grössten Umbau ihrer Strukturen seit Jahrzehnten beschäftigt.
2019 stimmte die Synode einem radikalen Plan zu, um die Kirche zukunftsfähig zu machen. Seitdem werden Kirchgemeinden fusioniert, Stellen neu zugeteilt und das Immobilienportfolio verschlankt. Die Anzahl der Pfarrbezirke wird von 45 auf 12 stark reduziert.
Zudem soll es künftig etwa ein Viertel weniger Pfarrstellen geben – auch, weil bei vielen Pfarrpersonen die Pensionierung bevorsteht und es immer schwieriger wird, frei werdende Stellen zu besetzen. Durch die neuen Strukturen werden zahlreiche Gebäude nicht mehr gebraucht. Deshalb sind derzeit rund 40 Immobilien zum Verkauf ausgeschrieben – von Kirchen über Gemeindehäuser bis hin zu Pfarrwohnungen.
Einnahmen schmelzen
Der Grund für den Sparkurs: Wie andere Kirchen in Europa hat die Church of Scotland seit Jahrzehnten mit starkem Mitgliederschwund zu kämpfen. Allein zwischen 2011 und 2021 verlor sie 34 Prozent ihrer Mitglieder, eine Trendumkehr zeichnet sich nicht ab. Derzeit zählt sie noch rund 280'000 Mitglieder. Auch das Einkommen der Kirche geht deutlich zurück, die Corona-Pandemie beschleunigte die Problematik zusätzlich.
Die Kirchen in Grossbritannien finanzieren sich grösstenteils über Zuwendungen ihrer Mitglieder. Weil die Pandemie und die nun steigenden Preise den Privathaushalten schwer zusetzten, wirkt sich das deutlich auf die Finanzlage der Kirchen aus. Für dieses Jahr budgetiert die Church of Scotland ein Defizit von 8,7 Millionen Pfund. Auch in den nächsten Jahren rechnet sie mit roten Zahlen in Millionenhöhe.
25 Millionen für neue Projekte
Doch es bleibt nicht beim Sparkurs allein. Um sich für die Zukunft fit zu machen, will die Kirche gleichzeitig kräftig investieren. Bis zu 25 Millionen Pfund sollen in den nächsten sieben Jahren in neue Projekte und den Gemeindeaufbau fliessen. Gerade jüngere Leute sollen künftig vermehrt angesprochen werden.
Die Kontakte zu Kindern und den unter 40-Jährigen seien bislang marginal, räumte im vergangenen Jahr der ehemalige Kirchenpräsident John Chalmers bei der Vorstellung eines Berichts zur Lage ein. Gespart werde nun nicht um des Sparens willen, sondern um neues Wachstum zu ermöglichen.
Schottland ist überwiegend protestantisch geprägt, die presbyterianische Church of Scotland ist Nationalkirche. Sie geht auf John Knox zurück, der im 16. Jahrhundert lebte und zeitweise nach Genf ins Exil fliehen musste. Dort war er ein Schüler des Reformators Jean Calvin. Die reformierte Kirche spaltete sich in Schottland 1560 von der katholischen Kirche ab. Wie bei allen Reformierten gibt es bei der presbyterianischen Kirche keine Messe und kein Zölibat.