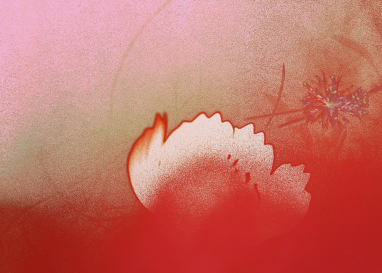Zsófia Varga hat die Ferse Gottes gepackt. So sagt man in Ungarn, wenn jemand Glück hat im Leben. Es geschafft hat, etwa in die Schweiz. Im Fall von Varga heisst das: Aufenthaltsbewilligung B, zwei Jobs in der Gastronomie, eine Einzimmerwohnung für sich und den zweijährigen Sohn, ein Einkommen von 2800 Franken netto. Und: der Ausstieg aus dem Sexgewerbe.
Ein neues Leben nach Jahren auf dem Strich
Die Ungarin Zsófia Varga hat die Sexarbeit aufgegeben. Die Mutter schaffte den Ausstieg mit zwei Jobs in der Gastronomie und der Hilfe der Beratungsstelle Isla Victoria.
Aussicht auf ein neues Leben: Zsófia Varga in der Beratungsstelle Isla Victoria. (Foto: Annick Ramp)

Die 41-jährige Ungarin, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sitzt auf dem grauen Sofa im sonnendurchfluteten Büro der Beratungsstelle für Sexarbeitende, Isla Victoria. Varga trägt schwarze Leggings, ein lachsfarbenes Shirt. Sie spricht gut Deutsch, dennoch bittet sie Beraterin Anna Maros zu übersetzen. In der Muttersprache fällt es ihr leichter, über ihr Leben zu sprechen. «Ich bin stark», sagt sie, «ausser wenn es um meine Vergangenheit geht.»
Seit fast 20 Jahren kennt Varga die Schweiz, vor allem die Strassenstrichs von Biel und Zürich. Immer wieder hat sie hier gearbeitet, 90 Tage im Jahr ohne Aufenthaltsbewilligung, wie es EU-Bürger dürfen. Bis sie vor drei Jahren schwanger wurde von ihrem Freund, einem ehemaligen Freier. Die Schwangerschaft sei der Wendepunkt gewesen, sagt Varga. «Ich wusste, ich will das Kind behalten, es ist vielleicht meine letzte Chance auf eine eigene Familie. Aber der Gedanke, diese Arbeit weiterhin zu machen, dann nach Hause zu kommen und meinen Sohn zu küssen, war mir unerträglich.»
Rätselhafter Kehrichtplan
Zsófia Varga ist Teilnehmerin eines Ausstiegsprojekts von Solidara Zürich, bis 2021 Stadtmission genannt. In der von den Kirchen mitfinanzierten Beratungsstelle an der Langstrasse ist die Ungarin angestellt, so erhielt sie die Aufenthaltsbewilligung und damit einen zweiten Job in einem Restaurant.
Solidarität mit den Schwächsten
Seit 160 Jahren setzt sich Solidara Zürich, bis 2021 Zürcher Stadtmission, für Menschen in Not ein. Einst von der Evangelischen Gesellschaft gegründet, standen in den ersten Jahren Krankenbesuche und aufsuchende Arbeit im Gastgewerbe und Rotlichtmilieu im Vordergrund. Heute betreibt Solidara Zürich das Café Yucca, einen Treffpunkt für sozial benachteiligte Menschen. Das Café ist auch Anlaufstelle für Passanten in Notlagen. Die Beratungsstelle für Sexarbeitende, Isla Victoria, unterstützt Menschen im Sexgewerbe in sozialen und rechtlichen Themen. Das siebenköpfige Team leistet auch aufsuchende Sozialarbeit und bietet Gesundheitschecks an. 2016 wurde die Zürcher Stadtmission ein eigenständiger Verein, die Evangelische Gesellschaft zog sich schrittweise zurück. Zusammen mit der christkatholischen Kirchgemeinde stellen die reformierte Kirchgemeinde Zürich und Katholisch Stadt Zürich mit rund einer Million Franken jährlich etwa 40 Prozent des Budgets.
In der Isla Victoria arbeitet Varga als Küchenhilfe, die Organisation kocht viermal die Woche rund 100 kostenlose Mittagessen für Sexarbeitende. Seit zehn Uhr war die 41-Jährige an diesem Morgen in der Küche zugange, schaufelte Reisportionen in Einweggeschirr, schöpfte das von einer Köchin in grossen Töpfen zubereitete Poulet-Curry. Der holzgetäfelte Aufenthaltsraum mit dem grossen Tisch und dem minzgrünen Sofa ist an diesem Montag gut besucht. Mehrere Frauen wollen an einer Online-Umfrage der Universität St. Gallen zu sexueller Gesundheit mitmachen und stehen vor zwei Tablet-Computern Schlange. Im Gegenzug erhalten sie Migros-Gutscheine. Die meisten der Frauen stammen aus Osteuropa oder Lateinamerika, einige aus Nigeria.
Sprache als Schlüssel
Anna Maros ist eine gross gewachsene Frau mit hochgesteckten blonden Haaren, blauen Augen hinter einem markanten, dunklen Brillengestell. In ihrem Büro sitzt jetzt eine Latina, sie ist Mitte 50 und benötigt Hilfe bei der Korrespondenz mit der Sozialversicherung.
Maros hilft, Steuererklärungen auszufüllen oder Formulare für Bewilligungen, sie geht mit ihren Klientinnen Kündigungen von Verträgen durch. Ihre Arbeit als Beraterin besteht teilweise aus Papierkram, der schon den Durchschnittsbürger überfordert, für viele Sexarbeitende wegen mangelnder Sprachkenntnisse aber unüberwindbar scheint. «Es kamen schon Frauen in Panik mit dem Kehrichtplan in der Hand und meinten, das sei der wichtigste Brief überhaupt», sagt Maros.
Die 50-Jährige stammt selbst aus Ungarn, studierte in Bern und ist mit einem Schweizer verheiratet. Für ihre Landsfrauen sei die Sprachbarriere besonders hoch, weil Ungarisch nicht mit anderen europäischen Sprachen verwandt sei und man sich nicht wie mit Spanisch oder Portugiesisch irgendwie durchschlagen könne. Die Sprache ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Spricht eine Sexarbeitende kein Deutsch, kann sie nicht verhandeln – über Preise, Dauer, mit oder ohne Kondom.
Mangelnde Kenntnisse der Landessprache verstärkten Abhängigkeiten, sagt Maros. «Wo es Abhängigkeiten gibt, ist Ausbeutung nicht weit.» Durch Zuhälter oder von ihnen eingesetzte Aufpasserinnen, die ihre Kolleginnen kontrollieren.
Maros kennt das Milieu gut, vor ihrer Arbeit bei der Isla Victoria war sie jahrelang in der städtischen Beratungsstelle Flora Dora tätig. Nebenbei ist sie Behördendolmetscherin, auch bei dieser Arbeit stehen oft Sexarbeitende im Zentrum.
Maros betont, dass das Milieu vielschichtig sei, manche Frauen und Männer, die gut Deutsch sprächen, verdienten sehr gut, suchten sich die Freier aus, hätten den Beruf bewusst gewählt. «Einzelne können tausend Franken pro Nacht verdienen, wo gibt es das sonst?» Doch sie suchen selten Hilfe in der Isla Victoria. «Zu uns kommen eher jene in prekären Verhältnissen.»
Kaum eine Wahl
Immer wieder ist Maros mit Fällen von Menschenhandel konfrontiert. Frauen oder Männer, die unter falschen Versprechen in die Schweiz gelockt wurden und ihre Reisekosten abarbeiten, später Einnahmen abgeben müssen, weil sonst die Familie im Heimatland bedroht wird. Ihnen bietet die Beratungsstelle Hilfe, stellt auch Kontakte zur Polizei und anderen Organisationen her.
Der Grossteil der Menschen, die von Zuhältern nach Zürich und in andere europäische Städte gebracht werden, wisse, welche Arbeit sie erwarte, erklärt Maros. «Doch die Freiwilligkeit ist relativ. Die meisten haben wirtschaftlich keine Option in ihren Heimatländern.»
Zsófia Varga erzählt, sie habe immer auf eigene Rechnung gearbeitet. Während sie über ihren Einstieg in die Sexarbeit spricht, hält sie sich an einem Glas Wasser und einer Zigarette fest. «In Ungarn hätte ich nicht genug verdient. Es ging ja nicht nur um mich, sondern auch um mei-ne jüngeren Geschwister.»
Alkoholsucht und Gewalt
Varga erzählt von alkoholkranken Eltern, einer gewalttätigen Mutter. In ihrem Heimatort nahe der ukrainischen Grenze sei sie nur acht Jahre zur Schule gegangen, habe daheim den Haushalt machen und früh Geld verdienen müssen. Als sich die Eltern trennen, bleibt sie mit den drei jüngeren Geschwistern bei der Mutter. «Mit 14 wollte ich freiwillig ins Heim, aber sie haben mich nicht genommen.» Sie wischt sich Tränen aus den Augen. Schliesslich setzt die Mutter sie vor die Tür. Varga will die Geschwister von der Mutter wegholen. Aber das Geld, das sie bei McDonald’s verdient, reicht dafür nicht aus. Auf der Suche nach besser bezahlter Arbeit kommt ihr der Strassenstrich in den Sinn. «Da dachte ich, das kann ich versuchen.»
Die Sexarbeit zahlt sich finanziell aus, Zsófia Varga mietet dafür eine kleine Wohnung an. Mit Mitte 20 hätten ihr die Behörden das Sorgerecht für die Geschwister zugesprochen, sagt sie. Das, obwohl man in Ungarn mit dem Beruf stigmatisiert sei. «Aber ich war offenbar immer noch besser als meine alkoholkranke Mutter», sagt sie und lächelt zum ersten Mal. Zunächst habe sie nur in ihrer Heimatstadt gearbeitet, später sei sie immer wieder in die Schweiz gereist. In Zürich steht sie am Sihlquai oder schaltet Online-Inserate. Das Geld schickt sie nach Hause zu ihren Geschwistern.
Anna Maros sitzt hinter ihrem Schreibtisch. Sie strahlt Ruhe und Verbindlichkeit aus, wenn sie für eine Klientin mit einem Vermieter telefoniert oder mit einer Krankenversicherung. Doch die Frage nach einem immer wieder geforderten Verbot der Prostitution lässt selbst Maros laut werden. «Wer gibt diesen Menschen dann anständig bezahlte Arbeit? Sollen ihre Kinder oder Familien verhungern?» Das Gewerbe bleibe ohnehin bestehen. «Bei einem Verbot verschwindet für die Sexarbeitenden die kleine Chance auf etwas Struktur, ein Minimum an Rechten und Sicherheit.»
Eine junge Brasilianerin kommt ins Büro, sie umarmt die Sozial-arbeiterin wie eine Freundin. Die Frau klagt über Unterleibsschmerzen, sie ist gekommen, da Isla Vic-toria auch kostengünstig Tests auf Sexualkrankheiten anbietet. Maros macht trotzdem einen Termin im städtischen Ambulatorium aus, sie tippt auf eine Blasenentzündung.
Sie kennt die Brasilianerin gut, seit deren Mutter während der Corona-Pandemie unerwartet starb. Das Team der Isla Victoria organisierte der Frau einen Flug nach Hause. «Die Reise dauerte 30 Stunden, sie kam gerade rechtzeitig zur Beerdigung», sagt Maros. Auch das sei eine Frage der Würde, die Möglichkeit, sich von einem geliebten Menschen verabschieden zu können.
Heute erzählt die Frau von einem Freier, den sie heiraten wolle. Sie hofft, ihre drei Kinder dann in die Schweiz holen zu können.
Der Traum von der Erlösung
Die Hoffnung auf den Ausstieg, auf Erlösung, sie schwingt in zahlreichen Gesprächen mit. Isla Victoria hat jedoch nicht primär den Ausstieg der Frauen zum Ziel, Sexarbeit ist schliesslich Arbeit. «Aber wir informieren sie über ihre Möglichkeiten, fördern ihre Eigenständigkeit und helfen dabei, eine Entscheidung zu treffen», sagt Maros.
Dass Zsófia Varga im Herbst angestellt wurde, war ein Entscheid des ganzen Teams. «Sie ist mutterseelenallein mit dem Sohn, und uns geht es auch um die Zukunft des Kindes», sagt Maros. Der Vater fällt finanziell aus, kümmert sich aber am Samstag um seinen Sohn. Denn Varga muss sechs Tage arbeiten. Fünf davon hat das Kind einen subventionierten Kitaplatz. «Arbeit, einkaufen, Haushalt und dann mein Kind abholen, so sehen meine Tage aus», erzählt die Ungarin.
Das neue Leben ist fragil
Erst vor drei Wochen unterschrieb Zsófia Varga den Mietvertrag für eine eigene Einzimmerwohnung. Die Miete beträgt 1200 Franken im Monat, das ist fast die Hälfte ihres Einkommens. Da der Sohn krank war und sie viel arbeitete, hat sie den Umzug noch nicht geschafft. «Jetzt freue ich mich darauf.» Ihr grösster Wunsch aber ist, irgendwann ein kleines Haus zu haben. «Mit einem Garten, in dem mein Sohn spielen kann», sagt sie und lächelt.
Noch ist das neue Leben fragil. Jedes Mal, wenn sie wegen des Kindes im Restaurant ausfällt, bangt Varga um ihre Stelle. Im Sommer macht der Betrieb Ferien, es droht ein happiger Verdienstausfall.
Freie Wochenenden hat Zsófia Varga keine, und Ferien kann sie sich nicht leisten. Aber Maros plant für ihre Klientin schon weiter, hofft auf besser bezahlte Jobs und irgendwann eine städtische Wohnung. Es geht jetzt darum, die Ferse Gottes auch zu halten.