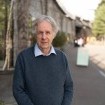Wer die öffentlichen Diskussionen zum demografischen Wandel verfolgt, bekommt zuweilen den Eindruck, dass die Schweiz in absehbarer Zeit ins Chaos stürzt. Der wachsende Anteil von Menschen, die über 65 Jahre alt sind, wird vor allem mit Kosten assoziiert. Als Belastung für das Rentensystem, das Gesundheitswesen und den Fachkräftemarkt.
Gebetsmühlenartig wird vorgerechnet, dass nach dem Zweiten Weltkrieg auf einen Menschen im Pensionsalter sechs Erwerbstätige kamen, derweil es in 30 Jahren nur noch zwei sein werden. Und dass bald Zehntausende Pflegebetten fehlen könnten.
Handeln, nicht jammern
Es sind Debatten, die nicht eben motivierend wirken, weder auf jene, die bereits zum «Alter» gehören, noch auf die Jüngeren, die darauf zugehen. Wer will schon permanent damit konfrontiert werden, dass man qua Jahrgang ein ungelöster Kostenfaktor ist? Dass man auf eine homogene Gruppe reduziert wird, der spezifische Vorstellungen über das Leben im Alter aufgestempelt werden?
Wie wohltuend ist da ein Blick in die vielen Initiativen, die in der Schweiz aus dem Boden spriessen und die Umkehr der Alterspyramide lustvoll angehen.