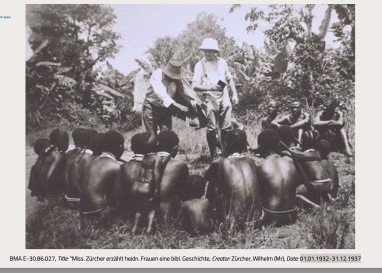Worum geht es bei der Initiative gegen Nahrungsmittelspekulation?
Jeannette Behringer: Die Initiative will die Spekulation mit Nahrungsmittelpreisen verbieten. Es geht um ein Verbot bestimmter Finanzinstrumente, welche die Nahrungsmittelpreise unberechenbar machen und tendenziell in die Höhe treiben. Davon profitieren dann nicht in erster Linie die produzierenden Bauern, sondern die Spekulanten an der Börse.
Martin Spillmann: Die Initianten wissen, dass Nahrungsmittel kulturell und religiös aufgeladen sind. Denken Sie nur an die Gleichnisse in der Bibel. Essen hat zudem einen erzieherischen Wert: Damit spielt man nicht. Auf dieser Klaviatur spielen die Jungsozialisten. Den Finanzinvestoren wischen sie auch gleich eins aus.
Behringer: Nahrung ist ein Menschenrecht und gehört neben Unterkunft und Kleidung zu den Grundbedürfnissen. Das halten auch die Menschenrechtscharta und die Sozialcharta der Uno fest.
Sind Nahrungsmittel für Sie ganz normale Investitionsobjekte, Herr Spillmann?
Spillmann: Nein. Sie sind speziell, weil sie lebensnotwendig sind. Es gibt Millionen von Menschen, die an Hunger leiden. Die weltweite Unterernährung ist ein ganz ernstes Problem. Trotzdem sind steigende Preise nicht nur schlecht. Sie führen dazu, dass wieder in die Landwirtschaft investiert und Agrarland bewirtschaftet wird, statt dass es verödet.
Behringer: Niemand behauptet, dass die Initiative das Hungerproblem löst. Aber sie korrigiert eine Entwicklung, die mit der zunehmenden Deregulierung der Märkte eingesetzt hat. Neu traten Akteure auf den Plan, die nicht mehr am Handel interessiert waren, sondern allein auf Preisanstiege spekulierten.
Termingeschäfte mit Nahrungsmitteln dienen eigentlich der Preisabsicherung.
Behringer: Termingeschäfte, bei denen ein Produzent seine Ware im Voraus zu einem fixen Preis verkauft und sich gegen das Risiko der Preisentwicklung absichert, werden nicht verboten. Problematisch ist, wenn durch den Verkauf von Derivaten und anderen Finanzinstrumenten der Markt mit Milliarden geflutet wird. Dann gehorcht die Preisentwicklung den Erwartungen der Spekulanten, und die Preise schwanken extrem.
Spillmann: Spekulation ist etwas Gutes. Sie pumpt Liquidität in den Markt. Ihr wird seit jeher vorgeworfen, Preise in die Höhe zu treiben. Bewiesen ist nichts. Schon 1760 wurde eine Reisbörse verboten. Seither gibt es keine Terminkontrakte und keine Börse für Reis. Trotzdem ist Reis das Lebensmittel, das den grössten Preisschwankungen unterworfen ist. Auf schlechte Ernten reagieren die produzierenden Länder mit Exportverboten.
Auch bei Nahrungsmitteln, die an der Börse gehandelt werden, schlagen die Preise aus.
Spillmann: Langfristig glättet die Spekulation die Preise. Finanzkonstrukte wie Terminverträge sind für die Preisfindung und die Risikoabsicherung wichtig. Sie garantieren, dass rechtzeitig Lagerkapazitäten aufgebaut werden. Steigende Preise am Terminmarkt sind ein Signal, dass sich eine Knappheit abzeichnet.
Behringer: Um Terminkontrakte geht es in der Initiative gar nicht, obwohl die Gegner gerne das Gegenteil behaupten. Sie bleiben explizit erlaubt.
Spillmann: In der Realität können Sie gute Händler nicht von bösen Investoren unterscheiden: Sie interagieren. An Rohstoffbörsen treten Produzenten oder Verarbeiter von Nahrungsmitteln genauso wie Finanzinvestoren als Käufer auf. Das ist das Tolle an der Börse: Sie bleibt im Gleichgewicht. Für jeden Handel braucht es Verkäufer und Käufer. Spekuliert einer auf schlechtes Wetter, muss ein anderer auf gutes Wetter wetten.
Behringer: Wir haben es jedoch nicht immer mit idealen Märkten zu tun. Es ist schädlich, wenn Banken und Hedgefonds in den Agrarmarkt drängen. Sie sind nur auf das Geld aus, das sie durch steigende Preise und damit durch eine Lebensmittelknappheit verdienen können. Sie wollen den kurzfristigen Gewinn und ziehen ihr Geld schnell wieder ab.
Spillmann: Rohstofffonds waren vor zehn Jahren angesagt. Inzwischen sind grosse Player wie die Deutsche Bank oder Credit Suisse ausgestiegen. Vielleicht wegen der schlechten Presse. Vor allem aber, weil sie nur Geld verloren haben damit.
Der Markt hat das Problem also gelöst?
Behringer: Im Gegenteil. Es sind Probleme dazu gekommen. Zum Beispiel mit dem Hochfrequenzhandel: Kauf und Verkauf gehorchen nicht mehr dem individuellen Entscheid eines Fondsmanagers, sondern sie werden durch von Computern generierte Algorithmen gesteuert. Dadurch kontrollieren nicht mehr Menschen die Entwicklung. Die Preise können in Windeseile unkontrolliert steigen.
Spillmann: Der Hochfrequenzhandel ist ein Problem, aber vor allem im Aktienhandel. Er führt dazu, dass eine Bank dank schnellerer Leitungen den Auftrag eines Kunden überholen und mit ihrem Auftrag die entsprechende Position einnehmen kann, damit sie vom Auftrag des Kunden profitiert. Der Hochfrequenzhandel verletzt die Fairness und muss deshalb eingeschränkt werden. Mit dem Rohstoffhandel hat dieses Problem aber nichts zu tun. Ich finde es schlicht unfair, damit Stimmung zu machen gegen die angeblich bösen Rohstoffspekulanten.
Wenn Spekulanten Nahrungsmittel zurückbehalten, weil sie auf weiter steigende Preise hoffen, handeln sie dann nicht unethisch?
Spillmann: Ihre Motive scheinen auf den ersten Blick egoistisch. Trotzdem bewirken sie Gutes: Verknappt sich das Angebot weiter, gibt es später wenigstens noch etwas zu kaufen. Preise messen Knappheit wie Thermometer das Fieber.
Und wenn das Thermometer kaputt ist?
Spillmann: Dann verliert der Investor Geld. Das Problem ist nicht der freie Markt, sondern dass Private oder Staaten wie China in Afrika ganze Landstriche aufkaufen. Und ein Drittel der Nahrungsmittel geht verloren beim Transport oder landet im Abfall. Da sollten wir ansetzen.
Behringer: Da sind wir uns einig. Wir müssen auch die Marktmacht von Unternehmen, die vom Anbau über die Logistik bis zur Verarbeitung die Wertschöpfungskette kontrollieren, kritisch hinterfragen.
Spillmann: Ebenfalls einverstanden.
Was passiert, wenn die Initiative vom Volk angenommen wird?
Spillmann: Der Agrarhandel wird weiterlaufen wie bisher – nur nicht mehr aus der Schweiz heraus. Vielleicht werden ein paar Firmen ins Exil gehen. Das Traurige ist aber, dass sich am Hungerproblem rein gar nichts ändern wird. Hier wird nach SVP-Manier ein Problem missbraucht, um Feindbilder zu pflegen.
Behringer: Produzenten können wahrscheinlich mit stabileren Preisen rechnen. Vor allem leiden Konsumenten nicht mehr so stark unter Preissteigerungen, da Investoren mit rein spekulativen Interessen vom Markt ferngehalten werden. In ärmeren Ländern haben bereits geringe Preissprünge existenzielle Folgen. Ausserdem geht die Schweiz als Drehscheibe im Rohstoffmarkt mit gutem Beispiel voran.