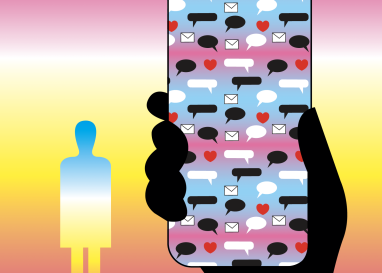Winterthur an einem Samstagmittag auf der Sportanlage Deutweg. Plötzlich jubelt das blaue Team am Spielfeldrand. Für Aussenstehende herrscht Verwirrung, warum auf der Anzeigetafel jetzt für die Zürcher in Blau Punkte notiert werden. Gespielt wird Cricket. Mit einem kleinen harten Ball, zwei Schlaghölzern und zwei Toren aus Holzstäben, die man Wickets nennt. Das Spiel erinnert an Baseball und doch ist beim Cricket alles anders.
Das Spiel der Kolonialisten fördert die Integration
In Asien, in Grossbritannien und Afrika ist Cricket populär. In der Schweiz hatte der Sport lange wenig Fans. Nun gibt es dank Ex-Pats und Geflüchteten immer mehr Vereine.
Exotischer Sport in Winterthur: Der «Zurich Crickets Cricket Club» und der «Winterthur Cricket Club» spielen mehr als fünf Stunden gegeneinander. Foto: Reto Schlatter

Es begann in einem Garten
Cricket ist für die meisten Schweizer ein Buch mit sieben Siegeln. Eigentlich ist das erstaunlich. Denn es geht um den zweitbeliebtesten Sport der Welt nach Fussball und um ein Milliardengeschäft. Patrick Henderson ist Präsident des «Zurich Crickets Cricket Club». Er kennt alle Regeln und weiss, warum internationale Spiele bis zu fünf Tage dauern können. Weil sein Sohn Nicolas schon als Kindergartenkind unbedingt Cricket lernen wollte, hat der britischstämmige Gymnasiallehrer ihm das Spiel im Garten beigebracht. Inzwischen ist Nicolas 21 Jahre alt und wartet auf seinen Einsatz als Schlagmann. Bis es so weit ist, erklärt er ein paar Grundregeln des Spiels: Zwei Batsmen schlagen die zugeworfenen Bälle möglichst weit ins Feld des Gegners, um Punkte mit Hin- und Herrennen auf dem Pitch, dem Herz des Geschehens, zu erzielen. Die Feldmannschaft wiederum versucht, das Rennen zu unterbrechen, die beiden Wickets zu zerstören oder die Schlagmänner auf andere Art ausscheiden zu lassen. Während sein Sohn um Punkte kämpft, notiert Patrick Henderson im Schatten eines Zeltdachs mit seinem Winterthurer Kollegen den Spielverlauf und alle Resultate. Nach jedem Over, das heisst nach sechs Bällen des Werfers, wird auf einer schwarzen Tafel der Spielstand angezeigt. Nach zweieinhalb Stunden ist die erste erste Runde abgeschlossen. Die Zürcher haben in 40 Overs 208 Punkte erzielt und acht Schlagmänner «verloren». Jetzt sind erst mal 20 Minuten Pause angesagt. Auf dem Grill brutzeln Pouletbratwürste. «Garantiert halal», sagt der Captain der Winterthurer, Mohammed Sameel. Er hat die Würste eigens in einer muslimischen Metzgerei gekauft.
Winterthurer Gelassenheit
«Beim Spiel wie beim Essen schauen wir darauf, dass niemand ausgegrenzt wird», betont der Tamile. Dass die Zürcher Spieler die kurze Pause sogleich für ein kleines Wurftraining nutzen, beeindruckt ihn nicht sonderlich. «Ach, sie sind halt Zürcher, wir Winterthurer nehmen alles etwas ruhiger.» Genauso wie die Mannschaft des ZCCC ist auch sein «Winterthur Cricket Club» multikulturell aufgestellt. Sameel ist vor Jahren als tamilischer Flüchtling in die Schweiz gekommen. Er kennt die integrative Kraft des Cricket. Die Spieler, die bereits länger in der Schweiz leben, helfen den Neuankömmlingen, sich am neuen Ort zurechtzufinden. Auch Singhalesen sind bei den Winterthurern mit dabei. «In Sri Lanka bekriegen wir uns, hier spielen wir zusammen Cricket», meint Sameel lachend, während er für die zweite Spielhälfte aufs Feld zusteuert. Jetzt stehen die Zürcher im Feld und die Winterthurer Schlagmänner auf dem Pitch.
Kein englischer Rasen
Der Pitch ist eine glatte, schmale Fläche von 20 Metern Länge. «Normalerweise besteht er aus englischem Rasen, millimetergenau gestutzt», sagt Alexander Mackay. Der Gründer des «Winterthur Cricket Club» ist stolz, dass er das Sportamt überzeugen konnte, hier am Deutweg einen Pitch aus Kunstrasen mit Betonunterbau zu installieren. Dank Expats und Flüchtlingen wird Cricket in der Schweiz immer beliebter, weiss Mackay. Er präsidiert den Verband «Cricket Switzerland » und liefert Zahlen: «Heute gibt es 28 Clubs, von denen 23 in der Liga und dem Cup spielen.» Sogar das Forschungszentrum Cern in Genf habe eine eigene Mannschaft. Im Moment sammelt Mackay gebrauchtes Cricket-Material. Es ist für Flüchtlinge bestimmt, Asylzentren hatten sich danach erkundigt.Viel mehr als Schlagbretter brauche es nicht, um spielen zu können, sagt er. Die meisten der Jungs hätten bisher nur mit Tennisbällen gespielt. Der «Hardball», der Cricketball, ist wenig grösser als ein Tennisball, aber fast viermal so schwer und schwirrt mit bis zu 150 Stundenkilometer durch die Luft. Darum tragen die Batsmen Helme mit Geschichtsschutz und diverse Polster. Alexander Mackay sitzt zufrieden in seinem Campingstuhl. Er hat allen Grund zur Zuversicht. Ein Sieg seines Teams zeichnet sich ab. Was er trotzdem vermisst: «Wegen Corona kam ich heute nicht zu meinem Curry.» Denn an den Spielen wird normalerweise Curry gegessen, manchmal auch das volle Programm mit Barbecue und Tee, Sandwiches und Cakes. Der Optimismus von Mackay bestätigt sich: Nach über fünf Stunden Spieldauer gewinnt Winterthur mit 209 Punkten und brauchte nur 33.3 Overs, um die Zürcher zu besiegen. Jubel und Zurufe auf Englisch, Schweizerdeutsch und Tamilisch unterstreichen nochmals die Internationalität des Sports. Der Zürcher Captain Nicolas Henderson ist enttäuscht vom Spielausgang. Denn in der wegen der Corona- Pandemie verkürzten Saison gilt bei den Erstligaspielen die Regel: Wer verliert, scheidet aus. Noch aber sind die Jungs vom ZCCC dabei beim «20 Over Cup», der kürzeren Wettkampfform neben der Meisterschaft. Im Cricket würde sich Frust aber niemals auf dem Feld entladen. wie das nach Fussballspielen nur allzu oft zu beobachten ist. Genauso werden die Entscheide der Schiedsrichter widerspruchlos akzeptiert.
Besser als die Kolonialisten
Cricket versteht sich als «Gentleman- Sport». Nicolas Henderson hat auch seine Maturaarbeit dazu geschrieben, um herauszufinden, weshalb der Sport der Kolonialisten in den ehemaligen britischen Kolonien heute noch so beliebt ist. Sein Fazit: Da die Einheimischen nicht mitspielen durften, gründeten sie eigene Mannschaften und wurden bald besser als die Briten. In der Not holten diese die lokalen Stars mit der Zeit in ihre Teams. «So beförderte der Sport letztlich den Kampf um die Unabhängigkeit.»