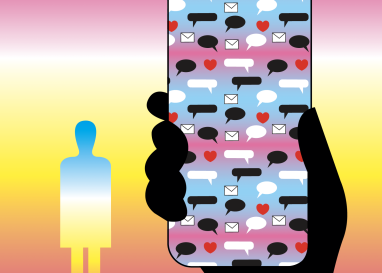Thomas war nicht dabei. Deshalb kann er die unglaubliche Geschichte nicht glauben. Jesus sei auferstanden. Drei Tage sind vergangen, seit der Hoffnungsträger am Kreuz gestorben und begraben worden ist. Und nun behaupten die anderen Jünger, sie hätten ihn gesehen.
Das ist zu viel für Thomas. Dem Evangelisten Johannes dient er als Identifikationsfigur für die Leserinnen und Leser. Denn auch mit ihrer Skepsis ist zu rechnen. Thomas will es genau wissen und verlangt den ultimativen Beweis: «Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und nicht meinen Finger in das Mal der Nägel und meine Hand in seine Seite legen kann, werde ich nicht glauben» (Joh 20,25).
Erstarrte Kronzeugen
Zweifel ist hier die natürliche Reaktion auf die Erzählung von der Auferstehung. Auf ganz eigene Weise begegnet das Matthäusevangelium der Skepsis. Es berichtet, wie die Hohepriester und Schriftgelehrten bei Pilatus, der Jesus zum Tod verurteilt hat, vorsprechen. Sie erinnern ihn daran, dass «jener Betrüger, als er noch lebte, gesagt hat: Nach drei Tagen werde ich auferweckt» (Mt 27,63). Pilatus soll das Grab bewachen lassen, um zu verhindern, dass die Jünger den Leichnam heimlich stehlen, um dann das leere Grab als Beweis für die Auferstehung zu verkaufen.
Um den Betrug auszuschliessen, versiegeln die von den Römern zur Verfügung gestellten Wachmänner den Stein, der vor das Grab gerollt wurde. Mit den beiden Frauen, die Jesus die Treue hielten und an Ostern nach dem Grab sehen wollen, zählt die Wache zu den ersten Zeugen der Auferstehung, die der Evangelist Matthäus als Spektakel schildert: «Es gab ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, kam und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf» (Mt 28,2). Das Grab ist bereits leer.
Die Frauen reagieren angesichts der göttlichen Offenbarung wie die Hirten auf dem Feld in der Weihnachtsgeschichte: mit Angst. Auch die österlichen Worte des Engels klingen wie ein Echo von den Feldern um Bethlehem: «Fürchtet euch nicht! Denn ich weiss, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten» (Mt 28,5).
Die Soldaten zittern vor Angst. Anders als die Frauen suchen sie nicht nach Christus, sie erstarren. Von den Hohepriestern lassen sie sich danach bestechen und erzählen fortan die Lüge, sie seien eingeschlafen. Deshalb halte sich das Gerücht, Jesus sei gar nicht auferweckt worden, «bis zum heutigen Tag» (Mt 28,15), schreibt Matthäus und setzt eine ironische Pointe: Die in die Ostererzählung eingewobene Verschwörungstheorie vom geraubten Leichnam gründet auf den Aussagen zweier Zeugen, die sagen, sie hätten den Betrug verschlafen.
Das Wunder als Ärgernis
Die Vorgänge rund um die Auferstehung beschreibt Matthäus ausführlich, doch der Vorgang selbst bleibt wie in den drei anderen Evangelien ausgeklammert. Der Stein vor dem Grab wird nicht weggerollt, um das Geheimnis der Auferweckung zu lüften, sondern damit sich die Besucherinnen und Besucher davon überzeugen können, dass Jesus nicht mehr bei den Toten ist. Das Bild für die Auferstehung ist das leere Grab. Wer an sie glaubt, muss sich von seinen Bildern lösen und sich einer Hoffnung anvertrauen, die nicht darstellbar ist.