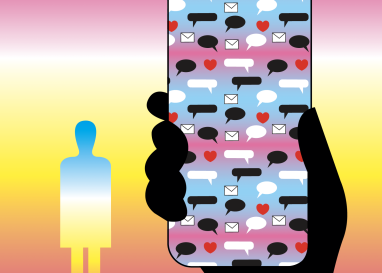Gibt es Geheimnisse des Glaubens?
Christine Stark: Der Glaube selbst ist für mich eine Bezugnahme auf das eine, grosse Geheimnis: Gott. Er ist aber nicht ein Geheimnis im Sinne eines Rätsels, das ich lösen muss. Er ist immer mehr als das, was ich mir vorstellen kann. Gott bleibt einzigartig, unverfügbar, unergründlich. Ich glaube also nicht an Geheimnisse, sondern mein Glaube bezieht sich auf das Geheimnis Gott.
Im Glauben ist die Gottesbeziehung wichtig. Wie soll das gehen, wenn Gott ein Geheimnis bleibt?
In jeder Beziehung bleibt doch das Gegenüber ein Geheimnis, selbst wenn ich jemanden sehr gut kenne. Vielleicht hält gerade dieser unverfügbare Teil die Beziehung interessant und lebendig.
In okkulten Religionen verfügen Priester über Geheimwissen. Gibt es das im Christentum auch?
Seit der Reformation gibt es zumindest in der evangelischen Tradition kein Geheimwissen mehr, über das nur ein exklusiver Zirkel verfügt und es als Machtinstrument einsetzen kann. Die Übersetzung der Bibel hat allen Gläubigen den Zugang zu den Texten eröffnet und der Geheimniskrämerei einen Riegel geschoben. Geblieben sind natürlich Geheimnisse wie das der «Amazing Grace», der wunderbaren Gnade, die in einem der berühmtesten Spirituals besungen wird. Die Gnade und die Liebe Gottes sind etwas vom Geheimnisvollsten überhaupt.
Warum soll ich mich dem Geheimnis Gott überhaupt anvertrauen?
Tatsächlich ist es eigentlich irr zu glauben. Irr in dem Sinn, dass ich die Existenz dessen, auf das ich meine Hoffnung setze, ja eigentlich mein ganzes Leben ausrichte, nicht beweisen kann. Ohnehin würde ich ganz reformatorisch sagen, dass der Glaube ein Geschenk ist. Auch dabei bleiben zu dürfen, wird mir geschenkt. Und ich denke, den Glauben zu verlieren, ist auch weniger ein Entschluss als ein Verlust.
Nützt denn der Glaube etwas?
Natürlich hoffe ich und habe die Erfahrung gemacht, dass mir mein Glaube hilft. Er ist eine Haltung zur Welt, die mich befähigt, Ungewissheiten auszuhalten. Ich weiss mich in etwas Grösserem aufgehoben und bin mir bewusst, dass ich über vieles nicht verfügen kann. Aber der Glaube funktioniert nicht auf Knopfdruck, weil er auf Vertrauen basiert. Vertrauen lässt sich nicht verordnen. Ich kann noch so viele Achtsamkeitsseminare besuchen, ich bleibe in bestimmten Situationen trotzdem misstrauisch. Ohne innerliche Absicherung gibt es kein Vertrauen und keinen Glauben.
Im Osterruf heisst es: «Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!» Glauben Sie das?
Ja. Der Glaube an die Auferstehung ist das erste Unterscheidungsmerkmal des Christentums. Wie wurde aus dieser jüdischen Sekte eine Religion? Indem die Menschen daran geglaubt haben, dass Jesus auferstanden ist. Der Auferstehungsglaube ist für mich bis heute der Kern des Christentums, auf den sich alle Kirchen einigen sollten
Oft wird die Auferstehung aber als Metapher verstanden, dass die Botschaft Jesu seinen Tod überdauert hat. Das wäre dann unchristlich?
Zumindest unbiblisch ist es schon. Apostel Paulus schreibt, ohne Auferstehung glaubten wir umsonst. Da bin ich nahe bei ihm. Wenn die Auferstehung nur noch als eine Metapher verstanden wird, droht sie bedeutungslos zu werden. Gute Metaphern finde ich auch in der Kunst oder in der Literatur. Ohne Auferstehungsglaube würde das Christentum seine Substanz verlieren.
Wie müssen wir uns denn die Auferstehung vorstellen?
Wir können sie uns gar nicht vorstellen. Da ist uns die Bibel im Weg, die vom leeren Grab erzählt, nicht aber vom Akt der Auferstehung. Sie interessiert sich nicht in einem heutigen geschichtswissenschaftlichen Verständnis für Jesus. Die Evangelien wurden im Rückblick geschrieben, aus der Überzeugung heraus, dass Christus auferstanden ist.
Wie reagieren Sie, wenn Leute den Glauben an die Auferstehung schlicht als Zumutung empfinden?
Dann sage ich, dass ich das gut verstehen kann, persönlich aber trotzdem an sie glaube. Die Auferstehung ist bezeugt in der Bibel, die das Zeugnis ist, in dem ich etwas über Gott erfahre. Dass ich die Auferstehung ins Zentrum stelle, bedeutet aber nicht, dass die Hoffnung, einmal von den Toten zu auferstehen, nun mein wichtigster Glaubensinhalt wäre. Vielmehr befähigt mich mein Glaube, mich getrost auf die Welt und das Leben einzulassen.
Woran zeigt sich das?
Aus dem Glauben an die Auferstehung erwächst ein ethischer Auftrag. Da verstehe ich sie im Sinne von Kurt Marti oder Dorothee Sölle schon auch metaphorisch: Auferstehung als ein Aufstehen für das Leben, für notleidende Menschen. Ich glaube, dass es unsere Pflicht als Christen ist, uns mit dem Schlechten in der Welt nicht abzufinden, sondern für das Leben einzustehen.
Erleben Sie manchmal Auferstehungsmomente mitten im Leben?
In der Natur, gerade jetzt im Frühling, überkommt mich manchmal eine Dankbarkeit für alles Leben. Auch in Konzerten erlebe ich das. Vielleicht banale Beispiele. Aber es sind geschenkte Momente der Zufriedenheit im wörtlichen Sinn: tief empfundener Friede, Glückseligkeit, Freiheit von Angst. Ohnehin ist das Christentum ja ein einziges Gegenprogramm zur Angst, gerade weil es in der Welt genug Gründe gibt, sich zu fürchten.