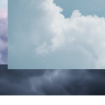Das Jenseits wird mit dem Reich des Todes und der Toten gleichgesetzt. Wie stellte man sich in der Antike diese Welt vor?
Tiziana Carraro: In der altgriechischen und altrömischen Vorstellung entspricht der Tod einem grossen Vergessen. Wer über den Fluss Styx gefahren wird, der taucht ein in dieses Meer. Der Styx markiert die Grenze zwischen den Reichen der Lebenden und der Toten. In einer alten süditalienischen Grabkammer ist ein Wasserspringer zu sehen, der eine Art Köpfler vom Einmetersprungbrett macht. Da haben wir eine erste Metapher: Das Wasser nimmt das Leben auf und bewirkt seine Auflösung. Dieses Bild findet sich auch auf römischen Sarkophagen: Wellenlinien symbolisieren den Eingang des Bestatteten ins Totenreich.
Finden sich solche vorchristlichen Ansichten auch im Christentum?
Ja, viele christliche Darstellungen haben einen heidnischen Ursprung. Zum Beispiel die Welt der geflügelten Wesen. Schon der griechische Liebesgott Eros war mit Flügeln ausgestattet. Die Putti und Engelswesen, die das christliche Jenseitsreich bevölkern, gehen auf die Eroten zurück, das sind die kleinen geflügelten Liebesbegleiter der antiken Liebesgöttin Aphrodite.
Das Wort Engel kommt vom griechischen «ángelos», was «Bote» bedeutet. Sind die Engel also die Botschafter zwischen der jenseitigen und der diesseitigen Welt?
Sicher, wir sehen das bei den Engeln in der Bibel, die ja Mitteilungen aus der Gotteswelt überbringen. Auch diese Vorstellung gab es schon in der Antike. Der Götter- oder Himmelsbote Hermes etwa segelte mit geflügelten Fersen oder geflügeltem Helm durch die Lüfte. Er überbringt die Botschaften schneller als der Wind. Die griechische Götterwelt des Olymps stellt eine recht menschliche Gesellschaft dar. Hier sind alle arbeitsteiligen Funktionen vertreten – vom Mundschenk bis zum Briefträger.