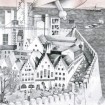1453 eroberten die Osmanen Konstantinopel – die Hauptstadt des griechischen und orthodoxen Byzanz. Der Fall Konstantinopels bedeutete den endgültigen Aufstieg des osmanischen Reiches zu einer Grossmacht und den Untergang des byzantinischen Reiches.
Erst mit diesem Ereignis konnte eine einheitliche Vorstellung vom christlichen Abendland entstehen. Denn bisher hatte sich das christliche Europa als lateinische Christenheit verstanden und sich bewusst von den orthodoxen Ostkirchen abgegrenzt. Es galt die Formel: Rom gegen Konstantinopel.
Der alte griechisch-lateinische Gegensatz wurde mit dem Ende des byzantinischen Reiches hinfällig. «Die Begriffe ‹lateinische Christen› und ‹Europäer› werden zusehends zur Deckung gebracht als eine politisch-religiöse Kennzeichnung», schreibt der deutsche Historiker Dieter Mertens in einem Artikel. Denn mit dem Vormarsch der Türken blieb nur noch eine der fünf kirchlichen Verwaltungseinheiten, der sogenannten Patriarchatskirchen, auf christlichem Boden übrig.
Der Bischof von Rom, der Papst also, wurde somit definitiv zur Leitfigur des christlichen Abendlandes. Die Kirchen Jerusalems, Alexandrias, Antiochas und Konstantinopels hingegen waren unter osmanischer Herrschaft.
Mit den beiden türkischen Belagerungen von Wien 1529 und 1683 verwandelte sich das «christliche Abendland» zunehmend in eine Kampfansage gegen die Türken. Europa als Sitz einer Christenheit sei als Gegenbegriff zu den Türken entworfen worden und sei so «eines der nachhaltigsten Konstrukte der Türkengefahr» geworden, schreibt die Historikerin Almut Höfert in ihrem Buch «Den Feind beschreiben».