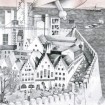Sollte man den Begriff christliches Abendland als politische Vokabel streichen?
Gerhard Pfister: Nein. Der Begriff taugt für die politische Debatte. Er umschreibt präzise die Prägung und die Herkunft unseres Rechtsstaates.
Wie ist der Rechtsstaat mit dem Christentum verbunden?
Pfister: Es gibt eine Ideengeschichte, die sagt: Aufklärung ist gegen das Christentum entstanden. Dem widerspreche ich. Im Dialog mit den christlichen Wurzeln hat sich die Aufklärung weiterentwickelt und dabei auch rechtsstaatliche Prinzipien erarbeitet.
Mit einem christlichen Geburtsschein für die Menschenrechte und Rechtsstaat verlieren diese an universaler Ausstrahlung.
Pfister: Tatsache ist, dass sich der säkulare Rechtsstaat nur in Gebieten durchgesetzt hat, wo eine christliche Kultur blühte. Ich halte nichts davon, dass man sich fremdschämt für die eigene Herkunft.
Können Sie, Esther Straub, der These zustimmen, dass Christentum und Rechtsstaat eng verknüpft sind?
Esther Straub: Es gibt Verbindungen, doch das bedeutet nicht, dass der Rechtsstaat christlich definiert ist. Wir sollten uns fragen, welche Assoziationen beim Begriff Abendland mitschwingen. Durch seine Geschichte hindurch diente er der Abgrenzung von anderen Kulturen – vom «Morgenland», von der griechischen Ostkirche, vom Islam. Und heute greift Pegida diesen Begriff in nationalistischer und rassistischer Weise auf.
Sehen Sie auch positive Aspekte mit dem Abendland verbunden?
Straub: Ich finde die Kombination der beiden Begriffe problematisch. Abendland ist eigentlich ein geografischer Begriff, da könnte man auch von Europa reden. Und christliches Abendland suggeriert eine geeinte Grösse, obwohl die Konfessions- und Nationalkriege ein anderes Bild zeichnen. Es ist ein Begriff, welcher der Wirklichkeit nicht gerecht wird.
Aber das Abendland hat mit dem mediterran-römischen Erbe auch eine grenzüberschreitende Dimension.
Straub: «Abendland» assoziiert Grenzziehung zum «Morgenland»: die morgenländische Glaubensspaltung, die Kreuzzüge, der Eiserne Vorhang im Kalten Krieg. Und heute wird der Begriff gebraucht, um sich von der islamischen Welt zu distanzieren.
Pfister: Hinter solchen Worten verbirgt sich eine unglaubliche Angst, zu dem zu stehen, was die Werte geprägt hat. Man redet schnell von Abgrenzung. Indes ist das Bekenntnis, dass unsere Gesellschaft christlich geprägt ist, weder abgrenzend noch ausgrenzend.
Straub: Zu Werten und Prägungen zu stehen, damit habe ich kein Problem. Wenn wir beim Wertebegriff sind: Werte gehören nicht wie Normen zum Rechtsstaat. Wir können uns Werte, die uns geprägt haben, neu aneignen oder uns von ihnen distanzieren – im Dialog mit anderen. Wesentlich ist für mich, dass wir nicht der Meinung sein sollten, wir würden bestimmte Werte besitzen und hätten ein Monopol auf sie. Statt aus einer Verteidigungshaltung eine Wertediskussion zu führen, sollten wir uns austauschen und Interesse zeigen an dem, was anderen wichtig ist.
Mehr dialogisch die Wertedebatte führen: Was meinen Sie dazu, Herr Pfister?
Pfister: Wer hat schon etwas gegen Dialog. Aber es gibt Gruppen, die das Gespräch verweigern. Vor allem da, wo eine Gruppe im Namen ihrer Werte oder noch schlimmer im Namen ihres Glaubens den Anspruch erhebt, rechtsstaatliche Regeln nicht zu akzeptieren, wird jeder Dialog überflüssig. Hier sind Gesellschaft und vor allem die Politik gefordert, die Einhaltung der Regeln einzufordern.
Sie spielen auf islamistische Gruppen an?
Pfister: Natürlich. Aber auch rechts- oder linksextreme Gruppen sind damit gemeint. Ich stelle bei vielen ein problematisches Verhältnis zum Rechtsstaat fest.
Straub: Dass die Einhaltung rechtsstaatlicher Normen Grundvoraussetzung für das gesellschaftliche Miteinander ist, bestreitet niemand.
Pfister: Doch, das bestreiten sehr viele in diesem Land. Es wird auch bestritten, dass dies überhaupt ein Problem ist. Damit ist der Fehler, den Frankreich und zum Teil auch Deutschland gemacht haben, programmiert. In Frankreich, in Belgien ebenfalls, gibt es gewisse Regionen, in denen der Rechtsstaat ausser Kraftgesetzt wurde. Wenn man sich scheut, die Wertediskussion zu führen, fördert man diese problematischen Tendenzen auch bei uns.
Wenn Sie die Beispiele Frankreich oder Belgien erwähnen, heisst es doch umgekehrt: In der Schweiz funktioniert die Eingliederung der Einwanderer besser.
Pfister: Ja, das stimmt. Weil wir eine offene Gesellschaft sind, weil wir schon früher über die Werte diskutiert haben und weil wir eine restriktive Einwanderungspolitik haben.
Frau Straub, wie stellt sich nun in Ihrer Gemeinde, dem multikulturellen Zürcher Stadtteil Schwamendingen, die Situation dar?
Straub: Im Kopf von vielen herrscht das Vorurteil, Schwamendingen sei wegen seiner Multikulturalität ein gefährliches Quartier. Das Gegenteil ist der Fall: Schwamendingen weist in der Stadt Zürich eine der tiefsten Kriminalitätsraten auf. Es ist ein Beispiel gelungener Integration.
Pfister: Da gehe ich mit Ihnen völlig einig. Die Schweiz ist in Europa die Gesellschaft mit der höchsten Integrationskraft. Das haben wir dem Festhalten an einer sogenannten restriktiven Migrationspolitik zu verdanken. Jedes Bemühen, bei der Ausländergesetzgebung konsequent zu sein, wird von der Linken torpediert.
Wo spüren Sie, Herr Pfister, dass christliche Werte in Gefahr geraten?
Pfister: Als Politiker habe ich rechtsstaatliche Werte zu verteidigen. Viele Leute sind besorgt, dass hier Menschen eingewandert sind, die die Regeln des Rechtsstaates nicht befolgen wollen. Es geht beispielsweise nicht, dass man sich in einem Land, wo die allgemeine Schulpflicht gilt, aus dieser herausstiehlt.
Straub: Schauen wir doch in die jüngere Geschichte zurück: Bis in die Neunzigerjahre hat die Politik in der Schweiz vielen Saisonnier-Kindern den Schulbesuch verunmöglicht. Und jetzt sagen Sie, es geht nicht, dass sich Ausländer aus der Schulpflicht stehlen. Entsteht aus den gleichen Werten unterschiedliches politisches Handeln? Warum haben wir denn damals trotz christlicher Werte nichts dafür getan, dass Kinder von Saisonniers die Schule besuchen konnten und sich nicht verstecken mussten?
Pfister: Hier muss man nicht mit christlichen Werten argumentieren, sondern mit den Werten des Rechtsstaats.
Straub: Wofür Einzelne einstehen, das hat mit Werten zu tun. Doch Sie verbinden den Rechtsstaat mit christlichen Werten, obwohl in einer pluralen Gesellschaft nicht nur Christinnen und Christen bestimmen, welche Normen gelten.
Pfister: Das habe ich auch nie behauptet. Ich habe nur gesagt, dass christliche Werte den Rechtsstaat geprägt haben. Das ist meine These. Der Rechtsstaatmuss sich durchsetzen, was er leider nicht in allen Bereichen tut.
Handelt es sich bei diesen Rechtsstaat-Verweigerern nicht um eine sehr kleine Gruppe innerhalb unserer Gesellschaft?
Pfister: Gegenfrage: Haben Sie den Eindruck, weil es in der Wirtschaft einige wenige Manager mit den Boni übertrieben haben, hätte man die Minder-Initiative nicht annehmen sollen?
Straub: Wollen Sie die Regulierung von Managerlöhnen in Analogie setzen zum Burkaverbot und meinen damit: Auch wenn es nur einzelne Frauen sind, die in der Schweiz eine Burka tragen, verbieten wir sie?
Pfister: Tatsächlich bin ich für ein Burkaverbot, weil es da um ein fundamentales Freiheitsrecht der Frauen geht. Dies nun von einer Quantität abhängig zu machen, halte ich für einen gefährlichen Relativismus.
Straub: Wenn es um die Gleichstellung der Frau geht, sind andere Fragen dann doch bedeutsamer, beispielsweise die Lohngleichheit.
Welche Grenzen diktiert das «C» im CVP-Parteinamen?
Pfister: Unsere Werte basieren auf den Menschenrechten und dem Rechtsstaat.
Straub: Keine Partei stellt den Rechtsstaat infrage. Und ausser der SVP, die mit der Völkerrechtsinitiative den Rechtsstaat über die Menschenrechte stellt, stehen auch alle Parteien vorbehaltlos hinter den Menschenrechten. Insofern sind sie nicht spezifisch für Ihre Partei, die CVP.
Pfister: Ja, aber das Spezifische der CVP zeigt sich in ihren politischen Entscheidungen. Vermutlich ist auch keine andere Partei gegen Freiheit oder Gerechtigkeit. Insofern können Sie nicht von unseren Idealen, die sich auf die christliche Tradition unseres Landes berufen, behaupten, wir hätten einen Exklusivitätsanspruch. Das haben wir nicht. Ebenso erwarten wir auch nicht, dass uns das ganze Land zustimmt. Es ist einfach so, dass etliche Menschen sich Sorgen machen.
Straub: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Ein christlicher Wert ist doch gerade die Sorglosigkeit: Sorget euch nicht! In Gelassenheit aufeinander zuzugehen: Das wäre doch eine Haltung, die unserer Gesellschaft guttäte.
Wie können sich christliche Werte in der Gesellschaft durchsetzen?
Pfister: Indem man Freiheitsrechte garantiert, oder indem man so weit wie möglich versucht, Gerechtigkeit herzustellen. Die Art und Weise, wie unser Rechtsstaat ausgerichtet ist, ist die politische Konkretisierung des Christentums. Und das gelingt in unserem Land recht gut, sonst wäre die Schweiz nicht eine der freisten und gerechtesten Gesellschaften, die es gibt.
Straub: Und genau diese Formulierung, der Rechtsstaat sei die Konkretisierung des Christentums, schliesst aus, dass Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht als christlich verstehen, diesen Rechtsstaat anerkennen können. Ist es nicht vielmehr so, dass der Rechtsstaat die Konkretisierung der Normen ist, auf die sich die Menschen, die in diesem Land leben, demokratisch einigen? Unabhängig von ihrer Religion?
Pfister: Mag sein, aber es bleibt dennoch eine Tatsache, dass es in keiner nichtchristlichen Kultur einen säkularen Rechtsstaat gibt.
Sie sagen, der Islam gehöre nicht zur Schweiz, die Muslime schon. Das ist paradox.
Pfister: Ich habe damit auf die Frage geantwortet: Was hat unser Land geprägt? Selbstverständlich hat uns das Christentum geprägt, nicht der Islam. Dennoch gehören die Muslime zu unserer Gesellschaft, nicht aber der Islam.
Straub: Auch wenn unser Land christlich geprägt ist – und ich bin meist stolz darauf –, müssen wir diese Prägung doch nicht wie einen Besitz verteidigen. Es geht vielmehr darum, dass alle Menschen, die in diesem Land leben, mit ihren Haltungen und ihrem Engagement die Gesellschaft gemeinsam weiterentwickeln. Dass wir miteinander im Diskurs sind und Normen aushandeln und festlegen.
Pfister: Da widerspreche ich Ihnen nicht. Im Gegensatz zu Ihnen erlebe ich aber diese Diskussion nicht als Abgrenzung. Was man meiner Meinung nach unterschätzt, ist, dass der Mensch Heimat braucht. Je globaler die Welt, desto wichtiger die Selbstvergewisserung in einer Heimat und in kulturellen Werten. Die Frage nach Verwurzelung, nach Identität wird wieder wichtiger, weil sie von der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung eingeebnet wurden.
Wie sehen Sie das als Pfarrerin und Seelsorgerin?
Straub: Aus theologischer Sicht gibt es für das Bedürfnis nach Identität keine einfache Antwort. Gott ist eben gerade kein Identitätsstabilisator. Das Revolutionäre an der christlichen Botschaft, wie Paulus sie verkündet hat, ist doch, dass die Glaubensidentität von anderen Identitäten losgelöst ist. Sie sprengt nationale Identitäten oder Geschlechteridentitäten, überwindet Klassenunterschiede und verbindet uns zu einer universalen Gemeinschaft.
Der Gekreuzigte lässt uns erkennen, dass wir nicht im Besitz der Wahrheit sind, und fordert uns auf, unsere Wahrheitsansprüche infrage zu stellen und Werte neu zu reflektieren. Es gibt nichts Kritischeres als das Kreuz, das die Weisheit der Welt zur Torheit macht. Christlich ist, sich dem Unerwarteten auszusetzen und auf den Anderen und die Andere zuzugehen.