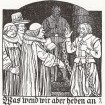Im Ortsmuseum des kleinen Dorfes Schleitheim im Kanton Schaffhausen zieht ein handflächengrosses Büchlein jährlich Hunderte von Besucherinnen und Besuchern aus aller Welt an. Bei diesem Schriftstück handelt es sich um die sogenannten Schleitheimer Artikel, die Bekenntnisschrift des Täufertums.
Zugleich gelten diese Artikel als Gründungsurkunde des protestantischen Freikirchentums. Das Buch im Museum Schleitheimertal ist eines von nur vier erhaltenen Originalexemplaren und das einzige öffentlich zugängliche.
Verfasst wurden die Schleitheimer Artikel, zwei Jahre nachdem der Zürcher Rat die Ausrottung der Täufer beschlossen hatte. Am 24. Februar 1527 fand an einem geheimen Ort in Schleitheim die erste Täufersynode statt, an der über den weiteren Kurs der Bewegung beraten und die Artikel beschlossen und niedergeschrieben wurden.
Akt der Abgrenzung
Federführend war Michael Sattler, ein zum Täufertum übergetretener Benediktinermönch und Prior des Klosters St. Peter im Schwarzwald. Sein Ziel war es, die Lehren und Auffassungen der Täuferbewegung zu vereinheitlichen. Einerseits, um der damals noch jungen Bewegung und ihren neu gegründeten, unabhängigen Gemeinden eine gemeinsame theologische Richtung zu geben. Und andererseits jedoch auch, um sich gegenüber – wie es in der Schrift heisst – «falschen Brüdern und Schwestern» abzugrenzen.
Der erste der insgesamt sieben Artikel definiert, was unter der Taufe zu verstehen sei. Das Sakrament wird als Glaubenstaufe an Erwachsenen vollzogen, «die über die Busse und Änderung des Lebens belehrt worden sind» und an die Auferstehung und die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus glauben. Die Kindertaufe wird abgelehnt.