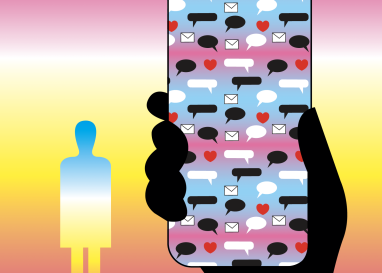In der Altstadt von Jerusalem, in der schwach beleuchteten Nische eines Antiquitätengeschäfts habe ich sie entdeckt: die Heilige Maria mit dem Jesuskind, in klassischer Ikonenmanier auf eine Holztafel gemalt. Da sassen sie im dunkelbraunen Gewand, und ihre püppchenhaften Gesichter waren umgeben von süsslichen Goldornamenten. Doch in ihrem Blick lag jene Tiefe, die ich in den Tagen zuvor in Jerusalem vergebens gesucht hatte.
Ich gebe es zu, von einer Stadt wie dieser, in der Juden, Christen und Muslime seit Jahrtausenden mit- und gegeneinander leben, erwartete ich, dass mich hie und da ein religiöser Schauer erfassen würde. Doch weit gefehlt. Vielmehr zwängte ich mich durch Touristenmassen, flüchtete aus überfüllten Kirchen, stolperte von einer Strassensperre zur nächsten und fühlte mich von einer Politik umzingelt, die ich jeden Tag weniger verstand.
Beim Feilschen versagt
Und da stand sie: Maria, mit den etwas zu gross geratenen, traurigen Augen. Und gleich daneben der Antiquitätenhändler, der mir die Nachbildung einer Ikone zu einem horrenden Preis verkaufen wollte.
Natürlich feilschte ich, nahm das Holzbrett aus der Nische, pustete den Staub weg und machte klar, dass diese Maria nichts als Pilgerkitsch sei. Doch ich hatte keine Chance: Ich blätterte viel zu viele Schekel-Noten hin und reiste mit dem Bild und gemischten Gefühlen zurück in die Schweiz. Seither blicken sie mich jeden Tag an, Maria und das Jesuskind. Und ich gestehe gerne: Der Pilgerkitsch ist mir jeden Schekel wert.