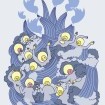Der Priester und der Tempeldiener sehen den Verwundeten und gehen an ihm vorbei. So erzählt es Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter.
Bestimmt haben beide Männer gute Argumente. Schliesslich können nicht alle Menschen gerettet werden. Und vielleicht wurde ihnen eine Falle gestellt, die Räuber halten sich hinter einem Fels versteckt und warten auf das nächste Opfer.
Ein schmaler Grat
«Ein Samaritaner aber, der unterwegs war, kam vorbei, sah ihn und fühlte Mitleid» (Lk 10,33). Jener, der hilft und das jüdische Gesetz der Nächstenliebe erfüllt, lässt sich von seinen Emotionen leiten. Mitleid ist ein Impuls, ein Gefühl, eine Form der Anteilnahme. Wer Mitleid hat, lässt sich vom fremden Schmerz berühren.
Doch das Mitleid hat eine dunkle Seite. Es kann in Überheblichkeit kippen, wenn sich eine Hierarchie einstellt zwischen dem Bemitleidenden und dem Bedürftigen. Niemand will bemitleidet werden.
Darum bleibt der Samariter nicht beim Gefühl stehen, er lässt sich davon bewegen. Der Affekt wird durch eine Haltung ersetzt, die das Gefälle beseitigt: das Mitgefühl. Wer empathisch ist, erkennt, dass der Grat zwischen Verschontem und Opfer schmal ist. Er rechnet mit der Möglichkeit, auf der anderen Seite zu stehen, und weiss um die eigene Verletzlichkeit.
Wer sich vom Mitgefühl leiten lässt, handelt nicht irrational. Im Ge-genteil: Der Samariter weiss, dass er das Problem nicht allein lösen kann, und bringt den Verwundeten in ein Gasthaus, übergibt ihn der Pflege des Wirts, den er gleich noch dafür bezahlt.
Hinter dem Tränenschleier
Mitgefühl hat eine schlechte Lobby. Der amerikanische Milliardär und Präsidentenberater Elon Musk bezeichnet die Empathie als «fundamentale Schwäche der westlichen Zivilisation», weil sie sich leicht ausnutzen lasse.
In dieser Logik ist kühle Distanz Voraussetzung für politisches und ökonomisches Handeln. Wer sich vom Leid rühren und davon beeinflussen lässt, blickt durch einen Tränenschleier auf die Welt, macht sich durch Schuldgefühle erpressbar, verliert den eigenen Vorteil aus den Augen.
Den Blick nicht abgewendet
Die Passionsgeschichte erzählt sowohl von der emotionalen Nähe wie von der Gefühlskälte. Da sind Frauen und Männer, die zu Jesus halten und unter dem Kreuz ausharren bis zuletzt. Zugleich beschreibt sie die maximale Distanz zum Opfer: den Spott. Die Soldaten machen sich lustig über den ohnmächtigen Gott: «Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst» (Lk 23,37).
Die Haltung, dass Menschen, die Opfer werden von Gewalt und Ungerechtigkeit, wenn nicht selbst schuld sind, so sich doch gefälligst selbst zu retten haben, ist verbreitet. Tatsächlich gilt es Menschen dazu zu ermächtigen, Verantwortung für ihr eigenes Leben zu übernehmen.
Doch wie lässt sich der Rahmen der individuellen Möglichkeiten abstecken? Wer kann sich selbst helfen und wer ist auf Hilfe angewiesen? Welche Bedingungen sind nötig, damit Menschen für ihr Leben Verantwortung übernehmen können?
Eine Frage der Übung
Der Schlüssel zur Antwort auf die Grundfragen des Zusammenlebens ist das Mitgefühl. Es vernebelt nicht den Blick, es schärft das Bewusstsein, dass der Mensch ein bedürftiges Wesen ist.
Empathie ist keine Schwäche. Sie ist die Grundlage der Zivilisation.
Und sie ist eine Haltung, die immer wieder neu eingeübt werden muss. Denn ohne Mitgefühl ist alles nichts. Ohne die Fähigkeit, sich ins Gegenüber hineinzuversetzen, ist kein Dialog möglich. Ein System, in dem jeder nur auf seinen Vorteil aus ist, muss kollabieren.
Der pragmatische Samariter
Religionen sind Schulen des Mitgefühls. Sie stiften Gemeinschaft und erinnern daran, dass Menschen aufeinander und auf Unverfügbares angewiesen sind. Sie rufen dazu auf, hinzusehen, sich berühren zu lassen vom Leid, um dann abzuwägen, welche Hilfeleistung selbst erbracht werden kann und inwiefern Menschen selbst in die Verantwortung genommen werden sollen.
So wie es der so barmherzige wie pragmatische Samariter im Gleichnis tut.